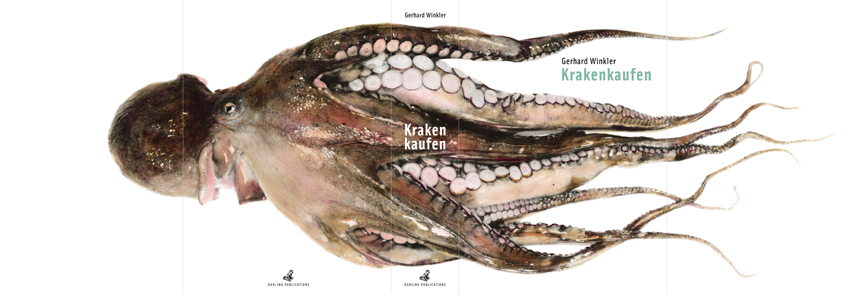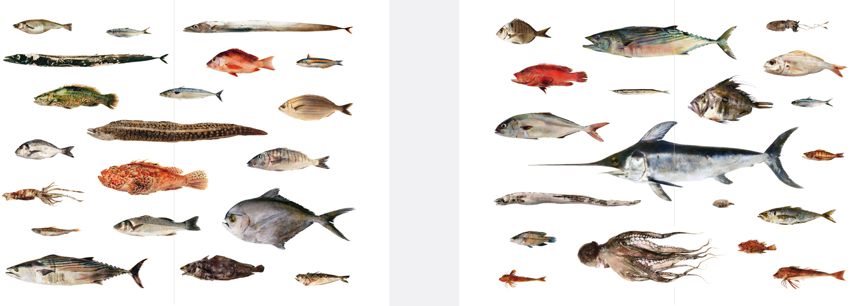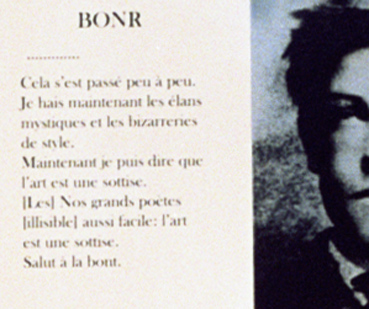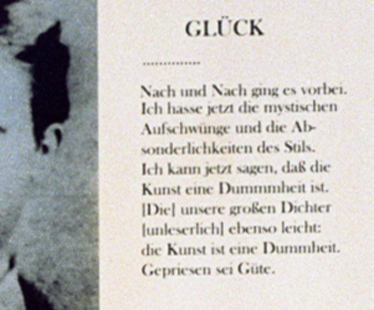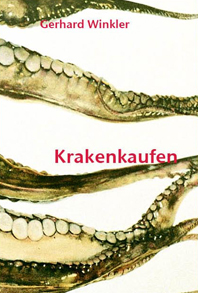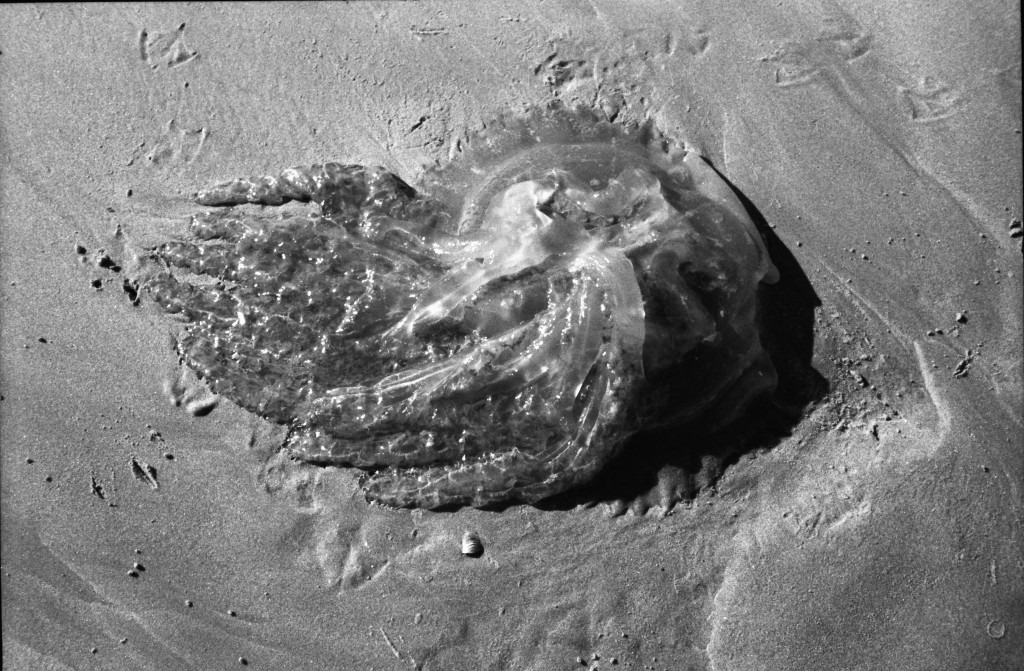Aus „Krakenkaufen“:
… Rouleau’s 1. Traum …
Ort: Marseille / Nancy
Zeit: im Sommer, ca.1994
III.Kapitel
Wieder Krakenkaufen
So könnte man also zu dem Schluss gelangen, dass es auf diesem Gebiet keine Zufälle geben kann. Auch keine Überraschungen. Im Grunde nicht einmal Abweichungen.
Horace Scott Howe
Das Dogma des Unabänderlichen in den Kulturen einiger indigener Völker.
Auch das Ungewöhnliche muss Grenzen haben.
Franz Kafka
Blumfeld, ein älterer Junggeselle.
Etwas später in selbiger Nacht läutete es an der Tür mit Nachdruck.
Rouleau, der sofort erwachte, sich aber erst einmal stellte, als schliefe er fest weiter, wurde mit jedem Läuten, das länger anhielt als das vorherige, klarer, dass dieses Geläute immer weitergehen würde, über Stunden, Tage, Ewigkeiten – bis er, Rouleau, letztlich doch die Türe öffnen würde. Also wälzte er sich endlich von seinem Lager, kroch zur Tür, an deren Rahmen er sich langsam aufrichtete, tastete sich durch das Dunkel des Flurs zum Lichtschalter. Geblendet stand er dann im Lichtkegel der Glühlampe über seinem Kopf und horchte auf die zwei Stimmen, die dumpf von jenseits der Eingangstür zu ihm hereindrangen.
»Nächste Woche auch wieder Nachtschicht?« fragte die eine.
»Zum Glück nicht. Zuerst drei Tagesschichten und dann den Rest der Woche frei. Muss dringend mal den Rumpf überholen.«
»Wenn man so ein Segelboot hat, hat man immer was zu tun, wie?«
»Und wie. Und Sie, Kollege?«
»Noch fünf Nachtschichten und dann endlich eine Sonder-Freischicht. Ich arbeite eigentlich gerne nachts, wenn nur der nächtliche Kantinenfraß nicht so abscheulich wäre.«
»Das ist er, weiß der Himmel, eine echte Zumutung«, bestätigte die andere Stimme.
In Rouleaus schläfrigem Gehirn bewegten sich gemächlich zwei Fragen aufeinander zu, trafen schließlich auch aufeinander, doch nur um sich dann gegenseitig umständlich im Wege zu stehen. Die eine Frage war die recht nahe liegende, ob er wache oder vielleicht doch noch in einem Traum befangen war, die andere war etwas komplexer und lautete: Warum müssen diese zwei »Kollegen« da draußen ausgerechnet hier und zu dieser Stunde arbeiten, und worin bestand am Ende diese Arbeit?
Mitten in diesen Gedankenstillstand schrillte wieder die Glocke hinein; ein biestiger, hysterischer und – wie ihm schien – immer lauter werdender Ton. Er seufzte noch einmal kurz und tief bevor er den Schlüssel umdrehte und die Tür aufstieß. Das Läuten riss sofort ab, und in der daraufhin eintretenden Ruhe musterte er zwei Herren in dunklen Anzügen, die sehr bunte und sehr breite Krawatten trugen, über denen ihre Gesichter ganz und gar insignifikant wurden. Sie standen so massiv vor ihm in der Tür, dass er das Gefühl hatte, nicht einmal eine Maus käme noch zwischen ihnen hindurch nach draußen. Der eine von ihnen hob den Arm und hielt ihm einen sandfarbenen Din-A-4-Umschlag vor die Nase.
»Einen guten Morgen wünschen wir, Monsieur. Wir sind vom Kulturamt und möchten ihnen dieses Dokument überreichen«, sagte er. Rouleau erkannte die Stimme des Bootsbesitzers.
»Zu dieser Uhrzeit?«
»Wir bitten das zu entschuldigen, aber die Dringlichkeit der Angelegenheit erlaubt keinen weiteren Aufschub. Und gestatten Sie mir bereits jetzt, Ihnen meine aufrichtigsten Glückwünsche auszusprechen.«
»Ich möchte mich dem anschließen, Monsieur: einen überaus herzlichen Glückwunsch auch von mir«, ließ sein Kollege sich verlauten, indem er sich sogar leicht verbeugte. Das sollte übrigens das einzige bleiben, was er im gesprochenen Wort zu dieser Angelegenheit beizutragen hatte.
Rouleau indessen wusste da bereits, um was es sich dabei handeln musste. Am meisten verwunderte ihn jedoch seine eigene Ruhe.
»Wir dürfen doch sicher eintreten, während Sie die Ernennungsurkunde und das Begleitschreiben in Augenschein nehmen? Vielen Dank. Bitte schön. Noch einmal herzlichen Glückwunsch.«
Nun zitterte Rouleaus Hand doch ein wenig, als er den ihm entgegen gestreckten Umschlag entgegennahm. Er musterte ihn lange, stumpf und ausdruckslos – so, als könnte er die Schriftstücke durch das verschlossene Kuvert hindurch lesen.
»Sie möchten ihn nicht erbrechen?« fragte der Wortführer vom Kulturamt mit gespieltem Erstaunen.
»Nun ja, doch – schon. Später vielleicht.«
»Wie es Ihnen beliebt. Sie werden auf jeden Fall noch genügend Zeit dafür haben. Wenn Sie dann die Freundlichkeit besitzen würden, das Nötigste …? Und bitte nicht mehr, als das, was Sie einhändig transportieren können. Ist das ihr Zimmer? Bitte nach Ihnen. Wir dürfen uns doch ein bisschen umschauen? Ich spreche natürlich von den Bildern an der Wand … Danke, sehr freundlich von Ihnen.«
Nachdem Rouleau die Stehlampe angeschaltet hatte, setzte er sich auf den Rand des daneben stehenden Korbsessels, dessen Sitzfläche fast ganz von einem Haufen frisch gewaschener, doch lose hingeworfener Kleidungsstücke eingenommen wurde. Währenddessen schlenderten die beiden Vertreter des Kulturamtes gemächlich an den Wänden des Zimmers entlang, mit auf dem Rücken gefalteten Händen, Kinn und Nase den Bildern entgegengestreckt. Einmal drehte sich der, der redete, zu Rouleau um und stellte fest:
»Sehr interessant. Man sieht an den Werken, dass man nicht den Falschen ausgezeichnet hat. Sind die alle neueren Datums?«
»Mehr oder weniger.«
»Meine Hochachtung, Monsieur. Das, was ganz einfach aussieht, ist doch stets das Schwerste, nicht wahr? Und beachten Sie doch nur einmal diesen Pinselduktus, Herr Kollege, irgendwie … schaumig, nicht? Wirklich, meine vollste Hochachtung, Monsieur. Wenn Sie dann bitte rasch das Nötigste …?«
Rouleau verstand und rappelte sich auf. Ratlos blickte er sich um. Er hatte nicht die mindeste Ahnung, was das »Nötigste« hätte sein können, aber immerhin erblickte er in einer Zimmerecke eine große, weiße Plastiktüte mit blauem Tati-Schriftzug. Sie war voller Pinienzapfen, und er hielt lange die geöffnete Tüte in den Händen und blickte nachdenklich hinein, gerade so, als würde er darüber nachdenken, ob vielleicht am Ende gar diese Pinienzapfen das »Nötigste« sein könnten. Endlich entschloss er sich dazu, den Inhalt der Tüte in den Papierkorb zu schütten, der aber schon voller zusammengeknüllter Skizzenblätter war, so dass ein Teil der Pinienzapfen in allen Richtungen über den Boden kullerten. Die beiden Herren standen inzwischen am Fenster und schauten auf den Nachthimmel über den Hausdächern des Quartier Belsunce; der Redner pfiff dabei, der Schweigende begnügte sich damit, sich im Rhythmus dieser Musik leicht in der Hüfte zu wiegen. Rouleau glaubte in der Melodie »Ne me quitte pas« zu erkennen, doch das war vielleicht nur Einbildung. Als der Pfeifer abrupt verstummte und sich fragend zu ihm umsah, stopfte Rouleau rasch Teile des vor ihm befindlichen Wäscheberges in die Tüte.
»Die Tüte wird unter diesem Gewicht reißen, mein Lieber. Diese Tati-Tüten halten leider nicht viel aus.«
Rouleau überlegte nicht lange, sondern wühlte wahllos die Hälfte des Tüteninhalts wieder hervor auf den Korbsessel.
»So wird’s gehen«, war sich der redende Kulturbeamte sicher. »Zahnbürste benötigen Sie nicht, die wird gestellt. Wenn wir dann noch Ihren Pass sehen dürften – nur um den Formalitäten zu genügen?«
Rouleau kramte in der Schreibtischschublade und fand schließlich seinen Reisepass. Die beiden warfen einen kurzen, ziemlich desinteressierten Blick hinein und der leitende Beamte nahm ihn daraufhin wortlos an sich und wies zur Tür. An der Garderobe griff Rouleau, ohne recht zu wissen, warum, zu seiner Schaffelljacke und seiner mit Schaffell gefütterten Ledermütze mit den Ohrenschützern. Die beiden Herren geruhten darüber zu lächeln.
»Wir unternehmen doch keine Expedition zu einem der Pole, Monsieur.«
»Ach nein, sicher. Aber ich fühle mich bereits jetzt etwas erkältet …«
Stumm marschierten sie dann die vier Etagen hinunter. Unten auf der Straße sog der Redebeauftragte des Kulturamtes Luft in die Lungen.
»Ah, das wird wieder ein schöner Tag werden. Alle Wolken haben sich verzogen. Die Sterne funkeln wieder über uns und bald wird eine herrliche Morgenröte aufziehen. Lassen Sie uns aufbrechen, meine Herren!«. Damit setzte er sich in Bewegung, die Rue Tapis vert hinauf in Richtung des Boulevard des Athênes, gefolgt von Rouleau mit seiner Plastiktüte, dem wiederum der schweigende Kulturbeamte auf dem Fuße folgte. Auf dem Boulevard angekommen, wandte sich die kleine Gruppe nach links. Also zum Bahnhof – dachte sich Rouleau und begann, noch fieberhafter nach Auswegen zu suchen.
Als sie sich auf Höhe der winzigen Epiçerie des alten Hakim befanden, verharrte Rouleau vor ihrer Tür wie ein störrisches Lastentier, so dass der davon überraschte Beamte hinter ihm förmlich über ihn stolperte. Im Inneren des Ladens sahen sie im Licht der einzigen Neonlampe das runzlige Gesicht des gebückten Hakim hinter einer Kiste hervorlugen. Er war gerade damit beschäftigt gewesen, den Laden für die bevorstehende Öffnung vorzubereiten und beobachtete nun gespannt die seltsamen drei Gestalten vor seiner Tür.
»Monsieurs, haben wir noch genügend Zeit, damit ich ganz kurz etwas einkaufen kann?« wollte Rouleau wissen.
»Das ist nicht nötig«, sagte flugs der wortführende Beamte, »für Frühstück und sonstige Verpflegung ist bereits auf das Verlässlichste gesorgt.«
»Ach so …« Und nach einer Pause: »Auch für Bananen?«
»Bananen? Ja, müssen es denn unbedingt Bananen sein? Bananen zum Frühstück? Ja? Also gut, gehen Sie schon hinein, aber beeilen Sie sich etwas, Monsieur.«
Nun klopfte Rouleau beharrlich an die Scheibe – tock, tock, tock … bis endlich der Alte missmutig, wohl bereits kommenden Ärger argwöhnend, hinter seinen Kisten hervorkam und die Türe aufsperrte.
»Guten Morgen, Hakim. Ich bin’s.«
»Das sehe ich. Was willst du zu dieser Zeit hier?«
»Bananen.«
»Bananen. Wie viele?«
»Viele.«
»Komm’ herein.«
Und das kleine Männchen trippelte hinter die Ladentheke, gefolgt von dem langen, hageren Rouleau, während sich die beiden Krawattenträger vom Kulturamt wieder in der bereits bekannten und effizienten Weise in der Tür aufbauten. Hakim musste die Hände fast bis auf Höhe seiner Brust anheben um sie auf den Ladentisch legen zu können; dann starrte er zu Rouleau hinauf und sah aus wie ein greisenhaftes, über alle Maßen misstrauisches Kind.
Rouleau beugte sich etwas zu ihm hinunter und flüsterte ihm zu:
»Hakim, was ich gleich tun werde, tue ich nicht gerne, das musst du mir glauben.«
»Ich glaub’ dir kein Wort, du Strolch«, erwiderte der Alte darauf ebenso leise. Laut sagte er aber: »Also Bananen, wie?«
»Ja, Bananen … oder vielleicht doch lieber die hier?« und Rouleau deutete dabei auf eine Kiste Orangen, die auf einer Ablage vor der Theke stand.
»Die kann man noch nicht essen. Die müssen erst noch auftauen.«
»Aha. Aber das ist ja umso besser.«
Und mit einer Schnelligkeit und Entschlossenheit, die man diesem schlaksigen, täppischen Menschen nicht zugetraut hätte, ergriff Rouleau die schwere Kiste mit beiden Händen und schleuderte deren sämtlichen Inhalt aus der Drehung seines Körpers heraus in Richtung Tür. Mit entsetzlichem Klirren gingen die Scheiben zu beiden Seiten der Tür zu Bruch, die Kulturbeamten aber – jeweils von einer beträchtlichen Anzahl halbgefrorener Orangen an Kopf und Körper getroffen – gingen geräuschlos zu Boden. Über sie hinweg sprang Rouleau mit einem weiten Satz ins Freie, begleitet von den kehligen, arabischen Flüchen des Ladeninhabers, und rannte den Boulevard hinauf in Richtung Gare St. Charles.
Als er keuchend und mit großen Sprüngen die neo-klassizistische Freitreppe hinauf rannte, zog im Osten über dem massigen, lang gestreckten Riegel des Bahnhofsgebäudes die erste Morgenröte auf. Oben angekommen, drehte er sich noch einmal um und warf einen letzten Blick hinunter auf die noch schlafende Stadt. Kein einziges Auto war auf dem Boulevard zu sehen, nur ein paar dunkle, unbeheimatete Gestalten schliefen in ihren zur nächtlichen Heimstatt gewählten Winkeln dem heraufziehenden Tag entgegen. Drüben auf ihrem Hügel verharrte Nôtre Dâme aufrecht auf ihrer erzenen, goldlackierten Weltkugel; in einem schrägen Winkel von etwa dreißig Grad über ihrem meerwärts gerichteten Haupt, weit draußen über der dunklen, glatten Fläche, glomm noch schwach der Polarstern. Ein paar verstreute Lichter waren schon in den tristen Wohntürmen in der Nähe des Centre Bourse angezündet worden, wahrscheinlich von noch schlaftrunkenen Bewohnern, die sich zur Arbeit fertig machen mussten. Rouleau aber suchte da unten angespannt nach zwei rennenden Gestalten, mit jeweils einem bunten Farbtupfer unterhalb des Kopfes, doch er konnte nichts dergleichen erspähen. Langsam begann er wieder ruhiger und gleichmäßiger zu atmen. Er wandte sich um und ging schnellen und entschiedenen Schrittes auf die Bahnhofshalle zu, die er durchquerte, ohne einen Blick auf die elektronische Anzeigetafel über ihm zu werfen. Er wusste, dass ihm ohnehin keine Wahl bliebe. Da sah er auch schon die weite Gleisanlage vor sich, auf jedem Gleis ein schwarzer Zug. Bei ihrem Anblick dachte er für einen Augenblick an ein Nest voller schlafender Riesenschlangen. Einzig am unteren Ende der Halle verschwand eine Handvoll eiliger Passagiere auf einem Bahnsteig. Dort musste also wohl in Kürze ein Zug die Stadt verlassen. Rouleau rannte so schnell er konnte. Als er auf den Bahnsteig einbog, ertönte von weit vorne neben der Zugmaschine der Pfiff eines Schaffners. Eine Sekunde, bevor der Zugführer alle Türen durch einen Knopfdruck schloss, konnte sich Rouleau gerade noch durch die Türe des letzten Waggons stemmen. Er drückte das Fenster eines leeren Abteils hinunter und streckte den Kopf hinaus, um den Bahnsteig zu beobachten, während der Zug den Bahnhof verließ. Er blieb aber leer und verschwand hinter ihm; an seine Stelle traten die Schatten stiller Gebäude: Fabriken, Werkstätten, uniforme Wohnblocks – Gegenden, die er nicht kannte, wohin ihn noch niemals ein Weg geführt hatte.
Rouleau war sich jetzt sicher, ihnen vorerst entkommen zu sein. Doch es war klar, dass sie ihn suchen würden und ihre Arme waren weitreichend und allgegenwärtig. Er legte die Beine auf seine gefüllte Plastiktüte im Sitz gegenüber und genoss für einige Minuten die unaufdringliche, von trüben Straßenlaternen schwach beleuchtete Landschaft, die dort draußen an im vorüber zog. Als der Zug gerade an den von Tausenden von Scheinwerfern beschienen Raffinerie-Anlagen am Golf vorüber fuhr, ging er in den Flur des Wagens, an die Stelle, an der er eben eine Karte des französischen Streckennetzes gesehen hatte. Einen Städtenamen nach dem anderen fasste er nachdenklich ins Auge. Paris – wie selbstverständlich im Zentrum des Landes gelegen: bloß nicht, es gäbe dort kein Entkommen für ihn. Immer angenommen, dass er es mit einem landesweiten Programm zu tun hatte: wie hätte dann nicht Paris das Zentrum, das Herz dieses Programms sein können? Bordeaux: seit Jahrhunderten waren hier die geborenen Verräter beheimatet. Toulouse: lag viel zu nahe an Marseille. Strasbourg: dort gab es mehr Misstrauen gegenüber Fremden als im ganzen restlichen Land zusammen genommen. Lyon: eine Stadt, die sehr groß war, doch eigentlich nur zur Durchreise taugte (er hatte im Übrigen nie verstanden, wie eine reine Durchreise-Stadt so groß hatte werden können). Würden sie ihn also dort vermuten? Vielleicht nicht. Doch schließlich entschied er sich auch gegen Lyon. Zu lange schon war er durch diese Stadt hindurch gefahren, mit dem Auto, mit dem Zug, hatte es im Flugzeug überflogen. Und ihm schien es jetzt schlicht zu spät dafür zu sein, daran etwas zu ändern.
Oben im Norden dann blieb sein Auge auf dem roten Punkt hängen, der mit »Nancy« überschrieben war. Nancy – eine Stadt, von der er im Grunde keine Vorstellung hatte. Doch plötzlich entsann er sich einer lange zurückliegenden Nacht die er mit einem ihm nur flüchtig bekannten und ziemlich heruntergekommenen Bildhauer aus Charlesville-Mezieres in der »Bar à Nour« verbracht hatte. Es war eine jener zahlreichen Nächte gewesen, die es besser nicht gegeben hätte. Eine Nacht wie ein übler Nachgeschmack, der sich hartnäckig im Mundraum festgesetzt hatte. Das einzige in dieser quälenden Nacht, an das er keine schlechte Erinnerung hatte, war eine kuriose, beinahe drollig zu nennende Geschichte, die ihm dieser alte Steineklopfer aus dem Norden damals erzählt hatte (während er ihm dabei konfus mit seinen vom Gebrauch von schweren Werkzeugen malträtierten Spinnenfingern vor dem Gesicht herumgefuchtelt hatte), die die »Brombeermenschen« in der Nähe von Nancy zum Thema gehabt hatte. Und mit einem Mal stand vor Rouleaus innerem Auge, neben der Absicht und dem Willen zu entkommen, ein geografisches Ziel, ein Ort, wo ihm Zuflucht immerhin im Bereich des Möglichen zu liegen schien. Ein Gebiet innerhalb der Grenzen dieses Landes, in dem die landesweiten Autoritäten mutmaßlich keine Macht besaßen, ja, vielleicht nicht einmal Zugang besaßen.
Wieder bequem über zwei Sitze im Abteil ausgestreckt, dachte er dann über die zurückliegenden eineinhalb Stunden nach; daran anknüpfend auch über die Natur und den inneren Mechanismus des Programms.
Gleich nachdem die beiden Beamten ihn beglückwünscht hatten, hatte er bereits gewusst, dass er zum »Künstler des Monats« gewählt worden war. Jeden Monat wurden mindestens ein, manchmal auch gleich mehrere Preisträger von einem Sondergremium der für die Kultur zuständigen Kommunalbehörde mit diesem Preis geehrt. Es handelt sich dabei jedoch – verkürzt gesagt – stets um Künstler, die von diesem Gremium aus Fachleuten als besonders entbehrlich für das kulturelle Leben von Stadt und Region erachtet werden. Rouleau hatte seine Person eigentlich stets als relativ sicher und für nicht preiswürdig erachtet, jedoch nur, weil eigentlich fast niemand in dieser Stadt bisher von seiner künstlerischen Existenz Notiz genommen zu haben schien, und die Behörde zudem in letzter Zeit eine Tendenz gezeigt hatte, vor allem solche Künstler auszuzeichnen, die durch eine hoch entwickelte Hybris auffällig geworden waren. Nun aber, als die beiden Krawattenträger vom Kulturamt vor ihm gestanden hatten, war ihm schlagartig bewusst geworden, dass natürlich schon die ganze Zeit über auch durchaus unauffällige Randexistenzen der Marseiller Kunstwelt immer mal wieder zum »Künstler des Monats« ernannt worden sein mussten, die Szene aber schlichtweg keine Notiz von diesen eher unspektakulären Fällen genommen hatte. Und nun war also die Reihe an ihm.
Man redete im Übrigen über das delikate Thema dieses Kunstpreises nicht gerne in der Öffentlichkeit, umso mehr und eifriger aber im kleinen Kreise und hinter vorgehaltener Hand, was naturgemäß die Entstehung von Gerüchten und kruden Theorien förderte. Einige Fakten aber waren hingegen klar und nicht von der Hand zu weisen. So gab das Marseiller Kulturamt zu Anfang jeden Jahres eine Art von Jahrbuch heraus, eine geheftete Broschüre, die die Lebensläufe und Portrait-Fotos der Preisträger des abgelaufenen Jahres enthielt, sowie jeweils eine ganzseitige Farb- und eine ganzseitige Schwarz-weiß-Abbildung mit Werken des Künstlers, begleitet von einem ebenfalls höchstens einseitigen Text aus der Feder eines Kunsttheoretikers oder Journalisten, der erläutern sollte, warum gerade dieser heuer zum »Künstler des Monats« gewählt worden war. Der Umfang dieser immer gleich aufgemachten Dokumentationen differierte indessen von Jahr zu Jahr, da es Jahrgänge gab, in denen vor Weihnachten und unmittelbar vor den Sommerferien gleich mehrere Künstler zu solchen des Monats berufen wurden. Es lag bereits eine stattliche Anzahl dieser Publikationen vor, welche in Fachkreisen durchaus Beachtung fanden und auch archiviert wurden, weil man schließlich nie wissen konnte, ob der ein oder andere dort aufgelistete Künstler nicht doch in naher oder ferner Zukunft, jedenfalls aber posthum, zum Gegenstand einer kunstwissenschaftlichen Forschungsarbeit aufsteigen könnte. Ein weiteres Faktum, das keinen ernstzunehmenden Anzweiflungen unterlag, war, dass die Preisträger zuhause oder im Atelier von einem Sonderkommando (von dem wiederum nicht klar war, ob es unmittelbar der Fremdenpolizei oder noch der Kulturbehörde unterstand) aufgesucht wurden, das ihnen die Ernennungsurkunde aushändigte, sowie ein Begleitschreiben, welches vor allem besagte, der Preisträger hätte sich sofort mit den Überbringern des Schriftstücks im Kulturamt einzufinden, zwecks eines vorbereitenden Gespräches, die Durchführung dieses begehrten Förderpreises, sowie begleitende individuelle Fördermaßnahmen betreffend. Danach verschwanden die Preisträger und man hörte nie wieder etwas von ihnen – abgesehen von der bereits erwähnten Publikation mit den zwei ganzseitigen Abbildungen zu Anfang des nächsten Jahres. Manch einer vertrat die Theorie, die Behörde würde vorzüglich solche Individuen aussuchen, die ihr laut Aktenlage besonders ungebunden und unverwurzelt erschienen, mit nur noch sehr losen familiären Verbindungen etwa, sowie natürlich in ledigem, kinderlosen Stand, was aber ohnehin auf die Mehrzahl der potentiellen Kandidaten zutraf. Nichtsdestotrotz sollte es aber bereits häufiger vorgekommen sein, dass Angehörige von verschwundenen Preisträgern Briefe mit schwer zu deutenden Inhalten oder Grußkarten mit einer nicht eindeutig dem Verschwundenen zuzuordnenden Handschrift erhielten.
Einigkeit bestand ferner über das Ziel dieser, von manchen als doch recht drastisch erachteten Fördermaßnahme, das nur darin bestehen konnte, die lange Zeit über geradezu kaninchenhaft anwachsende Zahl der sich als »Künstler« bezeichnenden und gebärdenden Individuen innerhalb des Marseiller Stadtgebietes wirksam zu reduzieren. Der Erfolg dieses Modellversuches war so durchschlagend, dass er bereits Gegenstand von mehreren Habilitationsarbeiten im gerade neu entstandenen Studienfach »Kulturmanagement« an der »Université de Provence« und sogar an der renommierten »Ecole du Louvre« gewesen war. Doch auch diesen wissenschaftlichen Publikationen war es nicht gelungen, endgültig zu klären, welchem Bereich der Kommunalverwaltung eigentlich die Auswahl und der Vollzug dieser Fördermaßnahme zuzuordnen war. Immerhin überwog die Ansicht, es müsse sich dabei um eine ämterübergreifende Kooperation handeln. So lag beispielsweise auf der Hand, dass die Nominierung das Kulturamt vornahm, während die Ernennung und die praktische Umsetzung in enger Zusammenarbeit mit dem Sozialdezernat durchgeführt werden musste – ging es dabei doch in ganz erheblichem Maße darum, dieses Ressort finanziell zu entlasten, da es sich bei den Preisträgern fast ausnahmslos um langjährige Empfänger von Sozialleistungen handelte.
Eine fast befremdliche Einigkeit herrschte aber in der Kunstszene darüber, dass die Juroren bei ihrer Auswahl stets Sachverstand bewiesen hätten, da die bis auf weiteres Verschwundenen durch die Bank nicht gerade eine schwer zu schließende Lücke in der städtischen Kunstwelt hinterlassen würden. Nicht selten gestanden sich etwa auf Vernissagen die Teilnehmer eines Kreises von in angeregtem Gespräch versammelten Künstlern gegenseitig ein, sie selbst– wären sie denn zum Juror für den »Künstler des Monats« berufen gewesen – hätten ganz sicher nicht anders entschieden als geschehen; die letzte Ausstellung des fraglichen Preisträgers wäre einfach unübertroffen schäbig und nichtswürdig gewesen. Und weil Künstler bekanntermaßen häufig einen ausgesprochenen Faible für gut darstellbare, da ostentativ extreme Haltungen besitzen, verkündeten einige – in offenbar vollster Gewissheit darüber, sie selbst würden niemals zu den potentiell Preisgefährdeten zu rechnen sein – lauthals und öffentlich ihre uneingeschränkte Sympathie für diesen »unorthodoxen, aber endlich einmal nachhaltig wirkenden Kunstpreis«. Zweifellos würden die Auslobenden (wer immer diese auch genau sein mochten) der gegenwärtigen Kunstproduktion einen nicht zu unterschätzenden Impuls geben – sei es doch endlich nicht mehr wie bisher als Selbstverständlichkeit zu betrachten, dass man ungestraft und missbräuchlich unter dem Schutzmantel eines unendlich geduldigen und schamlos ausgeweideten Kunstbegriffes den größten Unsinn verzapfen und sich danach auch noch leichthin der Justiziabilität entziehen könne, unter dem schnöden Hinweis, in der Kunst müsse alles erlaubt sein. Diese Zeiten seien nun auf immer dahin, und sie selbst würden dieser allzu permissiven, begriffsverwirrten jüngsten Vergangenheit auch keine Träne nachweinen, sondern vielmehr der im Dunkel verbleibenden Jury aufmunternd zurufen: Bravo, nur immer weiter so!
Auch ging von Anfang an die Rede davon, das Marseiller Programm sei ein Modellversuch, der – so er denn erfolgreich verlaufe – auf die ganze Republik ausgeweitet werden würde, insofern, dass er (falls in bestimmten Regionen des Landes einmal ein ähnlich akuter Bedarf dafür bestehen sollte) jederzeit ohne großen Vorlauf auch dort angewendet werden könnte – darin ähnlich den Bestimmungen gegen Tollwut-Epidemien oder Infektionskrankheiten etwa.
Soweit bestand im Großen und Ganzen eine relativ verlässliche Klarheit über den Zweck und die Struktur dieses modellhaften Programms. Nur in der nicht unerheblichen Frage, was eigentlich mit den Preisträgern nach deren Ernennung genau geschah, schossen die Theorien wild in das auch sonst nicht gerade spärlich wachsende Kraut des Marseiller Kulturklatsches.
Die prosaischste und in gewisser Weise auch unschlüssigste der verbreiteten Ansichten darüber war, dass die Preisträger noch in der Nacht ihrer Ernennung unter strenger Bewachung in einem Fischerboot in Richtung auf die zur See hin gelegenen Felswände der steil aus dem Meer aufragenden »Ile de Maїre« ausfahren, dort jedoch niemals anlangen würden. Immerhin war diese Mär so verbreitet, dass man diese Insel mitunter bereits als »Ile d’artiste inconnu« bezeichnete.
Eine weit zivilisiertere, obgleich bürokratischere Theorie besagte, die »Künstler des Monats« würden in einem nordfranzösischen Umschulungszentrum kaserniert, in denen sie nicht allein in Berufen wie Installateur, Gerüstbauer, Altenpfleger und einigen weiteren, für die eine gewisse Nachfrage bestand, ausgebildet würden. Parallel zu dieser Ausbildung würde ihnen aber auch durch eine aufwendige und langfristige psychologische Betreuung die nicht selten pathologisch ausgeprägte Überzeugung genommen werden, sie hätten in ihrem Leben eine wichtige künstlerische Mission zu erfüllen. Nach Abschluss der Trainings- und Ausbildungseinheiten würden die erfolgreichen Absolventen dann mit gezielt durchgeführten Maßnahmen von quasi chirurgischer Präzision in bürgerlich geordnete Welten re-implantiert werden, wo sie dann fortan einer acht- bis zehnstündigen Beschäftigung nachgingen, über deren Routine und Regelmaß sie ihre früheren, unglückseligen Ambitionen schließlich vollends vergessen würden. Die Rückfallquote, mutmaßte man, sei verschwindend gering.
(…)
An diesem Punkt seiner Überlegungen wurde Rouleau von einem Mann gestört, der unvermittelt in sein Abteil trat. Nachdem der Reisende etwas überrascht die blaue Uniform und die etwas alberne Schirmmütze des Herrn gemustert hatte, wandte er sich wieder von ihm ab, um seinen Blick erneut aus dem Fenster zu richten und weiter seinen Gedanken nachzuhängen. Der Uniformierte räusperte sich daraufhin und sagte förmlich: »Monsieur, ich stehe vor Ihnen im Auftrage der französischen Staatsbahnen SNCF in einem deren Fahrzeuge sie sich gerade befinden, wie Sie vielleicht auch schon festgestellt haben dürften, Monsieur. Dürfte ich also wohl Ihren Fahrschein sehen?«
Erst jetzt schien sich Rouleau des Umstandes zu erinnern, dass man in einem Zug eine Fahrkarte benötigte.
»Ich habe keinen«, gestand er sodann freimütig.
»Das habe ich mir bereits gedacht. In diesem Fall würde ich gerne ihre Carte d’Idendité in näheren Augenschein nehmen.«
Unwillkürlich vermutete Rouleau in dem Uniformierten einen ehemaligen Literatur- oder Philosophiestudenten. Er macht eine halb bedauernde, halb gleichgültige Kopfbewegung.
»Mein Pass liegt wohl inzwischen auf dem Marseiller Kulturamt«, mutmaßte er dann.
»Nun, dann sehe ich mich dahingehend veranlasst, unverzüglich mit der Bahnpolizei in Avignon telefonischen Kontakt aufzunehmen und um die Entsendung zweier Beamter zum Bahnsteig nachzusuchen, woselbst jene Ihre Person bei Ankunft unseres Zuges in Empfang nehmen werden, zwecks Feststellung Ihrer Personalien und so weiter.«
Das waren nun allerdings keine günstigen Aussichten. So sollte denn seine Flucht ihn gerade einmal bis nach Avignon führen … Für einen Augenblick dachte Rouleau an den kleinen Rimbaud, den sie aus einem Zug nach Paris umstandslos in ein Gefängnis verbracht hatten. Routinehalber kramte er jetzt in den Taschen seiner Schaffelljacke. Vielleicht hatte der Vorbesitzer ja ein paar Hundertfrancs-Scheine darin vergessen. So was soll öfters vorkommen. In einer der beiden Brustinnentaschen stieß er auf etwas Hartes, Flaches, Rechteckiges. Als er es herauszog, hatte er ein Stück Plastik mit Magnetstreifen und abgerundeten Ecken in der Hand.
»Eine Carte bleue «, sagte er überrascht. Hier war sie also die ganze Zeit über gewesen! Er erinnerte sich noch gut daran, wie er sie im letzten Winter erbittert gesucht hatte, dann aber aufgegeben und sich mit dem Gedanken getröstet hatte, es sei ohnehin hygienischer, kein Geld auszugeben, das man eigentlich nicht besaß.
»Ist die gültig?« fragte der Schaffner, nunmehr vage interessiert. Vielleicht könnte er sich doch noch den ganzen lästigen Umstand ersparen.
»Sicher«, behauptete Rouleau entschieden. »Marseille-Nancy einfach, bitte.«
Der Bahnbeamte steckte wortlos die Kreditkarte in ein Gerät, das ihm um den Hals hing und tippte auf dessen elfenbeinfarbenen Tasten. Wie durch ein Wunder schien die Maschine keinen Widerspruch anzumelden.
»Den hundert Francs Strafe für das Fahren ohne gültige Fahrkarte entgehen Sie aber nicht«, brummte der Uniformierte alttestamentarisch.
»Verkaufen Sie mir endlich eine Fahrkarte, Monsieur«, beschied ihm Rouleau und wandte sich wieder dem Fenster zu.
Es war immer noch Nacht, als der Zug durch die Schemen der in schwerem Schlaf liegenden Vorstädte Nancys fuhr. Säulen von weißem Dunst stauchten sich in den gelben Lichtkegeln der Straßenlaternen. Während der ganzen Fahrt war Rouleaus bisheriges Leben auf der spiegelnden Scheibe des Fensters vor ihm vorbei gezogen. Und jetzt also: Nancy. Er zuckte innerlich die Achseln darüber.
Dann versuchte er die Entfernung abzuschätzen, die er laufen müsse, um vom Bahnhof zurück zu gelangen in die Brachgebiete um die Eisenbahngeleise am Rande der Vorstädte. Er hatte sich die Stadt Nancy deutlich kleiner vorgestellt.
Als er kurz danach alleine auf dem Bahnsteig stand, begann er sofort zu frösteln. Die Hände konnte er noch tief in den Taschen seiner Lammfelljacke bergen, das Gesicht aber war den kalten Winden ohne Schutz ausgesetzt.
In der Bahnhofshalle waren bereits einige Läden geöffnet. Er lief an ihnen vorbei, als hätte er mit dieser Art von Leben nichts mehr zu tun. Der Gedanke, eine Zeitung zu kaufen, um zu erfahren, was es Neues geben würde, lag ihm völlig fern. Die Altstadt dahinter war fast menschenleer. Straßenkehrer fegten die Trottoirs der Boulevards; sie taten das so, dass zu befürchten stand, sie würden in ihrem ganzen Leben nicht mehr zu einem Ende damit kommen. Dunkle, graue Häuser zu beiden Seiten der Boulevards, mit Stürzen, Erkern und Fensterbögen – zu Ende des letzten Jahrhunderts errichtet von einer in Kriegen und Wirtschaftskrisen längst untergegangenen Klasse. Rouleau hielt sich immer in Nähe des Bahndamms.
Dann begannen die Wohnblocks. Sie hatten kleine Fenster, hinter denen sich die Schicksale von Menschen auf nach deren Bedürfnissen bemessenem Wohnraum erfüllten. Die Fassaden betonbelassen oder auch ganzflächig getüncht, hin und wieder verschiedenfarbige Streifen, Anklänge an konstruktivistische Farbgestaltung; an manchen Stellen war die Farbe in unterschiedlich große Placken aufgesprungen wie ein unfachmännisch gemaltes Ölbild. Kleine Balkone, von denen aus man möglicherweise genau zu erkennen vermochte, ob die abgewandte Schulter des Nachbarn wieder mal schuppenbedeckt war. In den unteren Bereichen dieser Wohnbehältnisse, auf den Türen und Garagentoren, sah Rouleau die schwarzen und roten Langeweile-Kringel von Jugendlichen, die zwar nichts Bestimmtes sagen, doch trotzdem Bleibendes hinterlassen wollten, zumindest bis zur nächsten administrativen Säuberungsaktion.
Rouleau fühlte sich in diesen Vorstädten, als würde er immer tiefer in die Misere einer Moderne hineingezogen, einer Moderne, die von einer eleganten, wenn auch leicht prätentiösen Dame über Jahre und Jahrzehnte hinweg zu einer alten Vettel heruntergekommen war, der nichts mehr peinlich war.
Er war deshalb recht erleichtert, als er die Region erreicht hatte, wo die Dornen ihren Anfang nahmen. Am Ende einer Siedlungsstraße war er auf einen gepflasterten Weg eingebogen. Unentschiedene Pflanzungen, ungepflegte Industriehöfe, verwilderte Wiesen, eine Hausruine, ein Reifenfriedhof hinter weißen Mauern, ein Lagerplatz mit Baumaterialien. Der Raureif über der Vegetation ließ das alles etwas freundlicher erscheinen, wenn es auch im Halbdunkel der morgendlichen Dämmerung leicht ins Gespenstische spielte.
Dann hatte auch dieser Weg ein Ende und vor ihm türmte sich eine weit gedehnte, undurchdringliche, meterhohe Wand von Dornengestrüpp. Rouleau nahm davor Aufstellung – ein langer Kerl mit vor Kälte ganz roter Nase, in einem Schaffell und einer Hose, die um ein Weniges zu kurz war. Er sammelte sich und all seinen Mut, begann dann mit dem Gesang. Zuerst leise brummend, doch dann allmählich lauter werdend. Er fror. Er war wütend. Wenn er wohl auch unbeobachtet war, so kam er sich dennoch albern vor. Doch gab es nun mal keine andere Hoffnung, keine andere Fluchtburg. Er sang immer dasselbe Lied, das zudem auch nur aus vier Zeilen bestand, da er wie gewöhnlich nur die erste Strophe des Liedes erinnerte. Mit langen Pausen dazwischen, in denen er still verzweifelte und weiß dampfende Flüche in die Kälte vor seinem Mund hauchte. Er sang »Le temps des mûres«. Das ging wie »Le temps des cerises«, nur eben mit mûres statt cerises.
Als er zum vielleicht sechsten Male bei Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au coeur … angelangt war, brach er das Liedchen jäh ab.
Es war zu blöd.
»Es ist zu blöd!« brüllte er, unverändert zur Hecke gewandt.
»Warum bist dann hier?« fragte eine dünnes Stimmchen. Sie kam mitten aus dem Dornengestrüpp und hatte einen seltsamen, kehlig-piependen Ton. Sie klang so altertümlich wie sich Pergament anfühlte. Rouleau wankte, er merkte es selbst.
»Was willst hier, Fremder?« fragte das Stimmchen noch einmal. Was will ich hier? – fragte sich der Fremde nun auch selbst und sagte doch kein Wort.
»Woher kommst denn?«
»Marseille.«
»Marzelle«, echote es schwach aus dem Dornendickicht. »Da is’ jetz wohl Sommer, wie?«
»Ja. Sommer.«
»Warum kommst dann hierher, Fremder?« wollte das Stimmchen zum dritten Male wissen.
Was sollte er schon sagen? Wenn einem partout keine Lügen einfallen, sagt man am Ende schließlich eben doch die Wahrheit.
»Sie haben mich dort zum ›Künstler des Monats‹ gewählt«, gestand er.
»Aha! Is’ mal interessant, das. Und nu?« fragte der Unsichtbare.
»Nichts. Ich wollte nicht. Und nun bin ich eben hier.«
»Ja, nu bist eben hier«, echote es gleichmütig.
Da hob sich mit einem Krachen und Ächzen ein kreisrundes Segment aus der ungeheuren Dornenhecke, klappte einfach so auf in den eisgrauen, morgenfahlen Himmel. Aus der so entstandenen Lücke im dichten Gewächs schoss der Oberkörper eines braunen Menschen hervor, dessen Bart- und Haupthaare sein Gesicht fast ganz überwucherten. Nur seine Nase leuchtete überaus rot darin hervor und bildete mit den zwei kohlendunklen, neugierig nach unten funkelnden Äuglein die unterschiedlich großen Punkte eines gleichschenkligen Dreiecks.
»Komisch siehst aus. Komische Jacke hast da an«, stellte das Männchen nüchtern fest.
Dann ließ es ruckartig und Stück für Stück eine primitive, aus Aststücken gefertigte, mit Hanfstricken zusammengebundene, auffallend hochsprossige Leiter aus seinem Loch bis zu Rouleau auf den Boden herab.
»Komm scho‘ rauf«, krächzte das Männchen zu ihm herunter, »aber pass auf, hier sind Dorne allüberall.«
Rouleau ächzte mit seiner Tati-Tüte die Leiter hinauf, Sprosse für Sprosse. Bald schon waren seine Hände an manchen Stellen von seinem Blut gerötet. Oben angelangt, packten ihn zwei behaarte Tatzen und zogen ihn mitsamt seiner Tüte in das Innere der Hecke. Rouleau sackte daraufhin in die Knie und besah sich seine blutenden Hände.
»So gings mir z’Anfang auch, aber mit der Zeit dann tuns gar nich’ mehr weh«, ermunterte ihn der kleine Braune.
Rouleau hob nun den Blick, um sich das Männchen genauer zu betrachten. Seine Kleidung war von einem fast einheitlichen Dunkelbraun, und das lag daran, weil große Erdplacken überall auf ihr hingen. Nur an manchen Stellen, wo die Schollen nicht mehr ganz vollständig waren, sah man so etwas wie einen schwarzen Pelz oder auch ein Fell darunter. Rouleau war sich auch nicht ganz schlüssig, ob der Kleinwüchsige kreisrunde, konisch ansteigende Fußbekleidungen aus getrocknetem Schlamm und noch feuchter Erde trug, oder ob diese Gebilde dem Körper zugehörten, mithin also diese bizarre Gestalt eine Art von Hufträger war. Sein dünnlippig verkrusteter Mund verzog sich jetzt zu einem Lächeln, das eine Reihe von in regelmäßigen Abständen stehenden, doch spitz zulaufenden Oberkieferzähnen entblößte. Rouleau erkannte nun ferner, dass das Gesicht der Kreatur mit einer Erdschicht bedeckt war, nur war diese viel feiner als die auf der Bekleidung. Sie schien wie dort festgebacken zu sein. Der Ankömmling wandte sich endlich schaudernd ab, und da sah er nun, dass er sich auf einer aus Ästen und rohen Brettern zusammengebundenen, runden Plattform von etwa zwei Metern Durchmesser befand, in deren Mitte eine Aussparung von etwa achtzig Zentimetern war. Durch diese nach unten spähend erkannte er eine orangefarbenen Kunststoffröhre, die in das obere Ende der Plattform eingelassen war, und die sich schräg nach unten schlängelte, wo sie sich in der Dunkelheit verlor. In unregelmäßigen Abständen ragten Bretter und Stäbe durch die Röhre, welche durch deren Plastikwände hindurchgingen und demzufolge ihren Halt wohl im Gestrüpp draußen haben mussten.
»Mein Nam’ is‘ Hyazinth. Ich bin hier der Büttel«, sagte da die Gestalt mit unüberhörbarem Stolz.
»Guten Tag. Ich heiße Rouleau.«
»Rollo? He, he, na dann komme mal mit, Rollo.«
»Gut, aber dürfte ich vorher noch wissen wohin?«
»Und is’ auch neugierig! Is’ auch neugierig, das Kerlche! He, he. Na, komm ma’ einfach mit: ich zeig dir z’erst bisschen was von unserer Anlag’. Guck mir nu’ immer zu, und mach’s dann ebnso.«
Und schon glitt er behende durch die Aussparung in der Mitte der Aussichtsplattform, in dem er seine Arme hoch über den Kopf streckte und die Hände zusammenlegte, um so eine schlankere Form anzunehmen. In dieser Haltung wand er sich durch die Öffnung und als letztes verschwanden die behaarten Hände in der Röhre. Ungelenk zwang sich Rouleau nun hindurch, blieb in Höhe des Brustkastens stecken, die Hände mit der Tüte nach oben gestreckt. Erst mit einer schmerzhaften Wendung konnte er sich befreien. Mit den Füßen voran schlug er daraufhin auf der Wand der Röhre auf, die nachgab und dabei gegen die sie umwuchernden Brombeersträucher schlug. Rouleau rutschte weiter und fand schließlich Halt an einer Planke in der sich seine langen Beine verfingen.
»Hi,hi – ‘s wird besser werden bald gewiss!« gluckste Hyazinth der etwas weiter unten auf einem Brett kauerte.»Guck nur her, Rollo, wie ich’s mach!«
Leichtfüßig sprang er jetzt hinab, von einer Sparre zur nächsten. War der Abstand zwischen ihnen zu groß, so sprang er zunächst einmal seitlich unter sich an die Röhrenwand von der er zurück federte und dann weiter unten auf dem nächsten eingelassenen Holz sicher ankam. Irgendwo hatte Rouleau diesen Bewegungsablauf schon einmal gesehen, er vermutete, es war bei madagassischen Brüllaffen oder verwandten Makaken in einem Zoogehege. Er selbst kugelte und stolperte hinterher, hinab in das Dunkel. Jedes Mal, wenn er sich etwas mehr seinem Führer annäherte, vermeinte er, dass der Geruch nach feuchter Erde zunähme. Nach einigen Metern, die sie in nahezu vollständiger Dunkelheit nach unten gestiegen waren – Rouleau fiel freilich mehr, als dass er kletterte, während der Erdmensch weiterhin elegant wie ein Eichhörnchen von Planke zu Planke hinab glitt – , gelangten sie in einen niedrigen Schacht. Rouleau spürte nun das Erdreich unter seinen Füssen. Unversehens machte Hyazinth merkwürdig zappelnde Bewegungen, und da blendete sie auch schon das Licht eines starken Scheinwerfers. Vor ihnen hing ein Baulampe mit Bewegungsmelder und tickender Zeituhr. Man sah nun, wie der Schacht aus dicken Ästen, Kanthölzern, Verschalungsbrettern, überhaupt aus Bauholz aller Art zusammengezimmert war.
Schweigend gingen sie den langen Gang entlang; Hyazinth musste dabei seinen braunen, haarverfilzten Kopf nur noch etwas tiefer zwischen die Schultern ziehen, während der Neuankömmling hinter ihm sich in unbequem gebückter Haltung vorwärts schieben musste. Immer mal wieder verfing sich seine Schaffelljacke in den Dornen von Zweigen, die den Weg von außerhalb durch kleine Ritzen in den Schacht gefunden hatten. Zudem blieb er wiederholt an rostigen, unvollständig und schief eingeschlagenen Nägeln hängen, wobei er jedes Mal gewohnheitsmäßig Putaine! ausrief.
»Hi, Hi, ›Putaing!‹ sacht er«, gluckste dann Hyazinth vor ihm, »musst halt besser gucken und nicht ›Putaing!‹ Hi, Hi!«
Kurz darauf gelangten sie an eine Wegkreuzung auf der sich ein stattliches Gestrüpp in den Schacht Bahn gebrochen hatte. Hyazinth bog die Spitzen der Zweige mit seinen bloßen Händen zurück und versenkte sie im Buschwerk, indem er die Zweigenden um ihre Basis wickelte.
»Tscha, allhier müsst auch wieder ma’ g’putzt werd’n«, ließ er dabei verlauten und gab, als er seine Wickelarbeit beendet und eine ausreichend große Passage geschaffen hatte, Rouleau ein Zeichen, ihm zu folgen.
Sie bogen nach links ab, in einen Schacht, der genauso niedrig war wie der erste. Rasch verlor sich darin das Restlicht, das noch aus dem vorigen in ihn fiel, und sie tappten etwas weiter im Dunklen bis Hyazinth wieder ohne Vorankündigung innehielt, so dass Rouleau dabei auf ihn auflief. Der Erdmann vollführte daraufhin ähnliche Faxen und Luftsprünge wie gerade eben schon. Und wieder setzte er damit einen Bauscheinwerfer in Gang, dessen Lichtkegel in eine Öffnung fiel, die sich an einer Seitenwand des Schachtes auftat. Sie gingen hindurch und gelangten in einen quadratischen Raum mit etwa vier Meter Seitenlänge, dessen Wände aus fest gefügter Erde zu bestehen schienen, die in ihrer Beschaffenheit ganz den Erdplacken auf Hyazinths Körper glich. Auf einer Wand hing eine gesprungene Schiefertafel von der Art, wie man sie vor langer Zeit in Elementarschulen verwandt hatte. Auf dem dunkelbraunen Boden standen kleine Tische und Stühle, wie für Zwerge gemacht, alle aus Presspanplatten und einfarbigen Furnierplatten von billigen Möbeln angefertigt. Dazwischen einige grob zusammengefügte kleine Wägen aus den nämlichen Materialien mit verschieden großen Rollen von offensichtlich ganz unterschiedlichen Herkünften. Ein größerer Wagen war mit vier Scheiben aus einem Baumstamm versehen und hatte eine ungefähre Ähnlichkeit mit einem Automobil. All diese Gegenstände warfen in dem schräg einfallenden Scheinwerferlicht lange, kuriose Schatten. Rouleau besah sie sich mit hochgezogenen Augenbrauen.
»Für unser’ Kleine’«, säuselte Hyazinth und zog vor Rührung seinen Mund nach vorne, wodurch seine ohnehin kleinen Äuglein noch etwas verkniffener wurden. Dabei rieselte etwas Erde aus seinem Gesicht zu Boden. Rouleau betrachtete erstaunt sein Profil, das jetzt dem eines Maulwurfs ähnelte.
»Unser Kindergarte’ is’ des! Und bald braucht’s auch ein’ Schul! Komm, lass uns in’n Hof gehe’!«
Sie zwängten sich durch eine mit Brettern befestigte Öffnung seitlich neben der Schultafel und gelangten auf ein kreisrundes Terrain von etwa sechs Meter Durchmesser. Auf dem Boden war Sand aufgeschüttet, hier und da entsprossen einige Grasbüschel. Der ganze »Hof« aber war rundum meterhoch umstanden von Brombeerhecken, die feindselig und gierig diesen nackten, beinahe vegetationslosen Boden zu belauern schienen. Als sie zur Mitte des Platzes gingen, konnte Rouleau sogar oben zwischen dem sich auftürmenden Gestrüpp ein Stück des immer noch grauen Morgenhimmels sehen.
»So was kost’ viel Arbeit«, wusste Hyazinth, »da hat ein Mann ganz allei’ mit zu tun: schneide, schneide, schneide – Tagaus, Tagein. Schnipp-Schnapp!«
Sie gingen zurück durch den Kindergarten und in den Schacht, wo ihnen kurz darauf zwei Gestalten entgegen wankten: eine große in gebückter Haltung und eine kleine an ihrer Seite. Rouleau vermochte in der großen eine Frau erkennen, deren Umhang genauso erdverkrustet war wie Hyazinthens Fell, ihr Haar war ebenfalls völlig zerzaust, ihr Gesicht war ebenso bräunlich, wenn auch ohne Gesichtsbehaarung. Rouleau hätte nicht mit Sicherheit zu sagen gewusst, ob die kleine braune Kugel neben ihr ein Mädchen oder ein Junge war. Das Kind trug auf dem Rücken einen Behälter, der aus gelblichen Marmordekor-Furnierplatten zusammengenagelt war und mit Stücken von Rolladen-Gurten dort gehalten wurde. Sobald Hyazinth das Paar gesehen hatte, begann er damit, überschwängliche Begrüßungszeremonien zu praktizieren, die Rouleau an gewisse tierische Verhaltensmuster erinnerten. Dabei hob und senkte er in stakkatoartigen Bewegungen die weit von seinem Körper gestreckten Arme mit den fächerartig gespreizten Fingern daran, währenddessen er sein rundes Kinn in einem gegenläufigen Rhythmus zuerst auf den Brustkasten drückte, um seinen Kopf daraufhin weit nach hinten in den Nacken zu legen. Die Frau machte die gleichen Exerzitien, wenn auch deutlich zurückhaltender. Das Kind dagegen begann, mit gebeugten Knien zu watscheln, was es noch mehr wie eine befußte Kugel aussehen ließ.
»Kutmork, Fantin Schenevieev!« krähte Hyazinth.
»Kutmork, Fant Hyasind!« lispelte die Erdfrau.
»Viehgoods? Olle well, sowyd?« begehrte der Büttel zu wissen.
»Joo, olle well, well. Joo, joo. Donk, donk.«
Hyazinth kniff das Kind leicht in die Backe, wodurch sich in der obersten Lage ein wenig Erde ablöste. Es lächelte schüchtern, und Rouleau erschrak etwas über die haifischzahnspitzen, perlweißen Zähnchen im Mund des kleinen Erdkindes, die dabei sichtbar wurden.
»Goodsoo. Undekloodoo? Scheehbroof ?«
Und da die »Fantin Schenevieev« darauf anscheinend nicht so recht eine Antwort hatte, deutete Hyazinth nach einer kurzen Pause mit einem seiner schwarzerdigen und mit Borsten bestandenen Griffelfinger in Richtung Kindergarten und sagte: »Noghkoodoo. Syds premmjers. Waards hallt bisghe. Scheedagh, Fantin Schenevieev!«
»Scheedagh ogh, Fant Hyasind.«, wünschte die Frau und zog die kleine Kugel neben ihr rasch mit sich fort.
Hyazinth schaute den beiden mit einem wohlwollenden Lächeln nach. Er hatte eben gerade so gesprochen, als hätte sich auf einmal mehrere feuchte Lehmbrocken unterschiedlicher Größe in seinem Mundraum befunden, durch deren aneinander kneten und wieder voneinander lösen sich erst die Worte gebildet hätten.
»Das war Geneviev«, raunte er nun Rouleau in seinem vorherigen, seinem Gesprächspartner angepassteren Idiom zu, »wahrscheinlich die best’ Mal’rin allhier.«
»Malerin? Was malt sie denn?«
»Stilleben. Mit Brombeers. So plastisch, als wenn man sich reinsetze’ könnt’. Werd’ dir nachher Bilders von ihr zeig’n in unser’m Museumsneubau.«
»Aha. Und wieso hast du so eigenartig mit ihr gesprochen?«
»Eigenartig?« echote er und lachte dabei knatternd. »Ei, des war brombonisch, unser Landessproch!«
»Unsinn, das war französisch, nur völlig degeneriert.«
»Degeneriert?« brauste der Erdmann mit einem Mal auf, und schien dabei etwas in die Höhe zu wachsen. »Degeneriert französisch? Is’ dir klar, Rollo, dass ich dir für die herabwürdigend’ Äuss’rung über unser’ Muttersproch kraft meins Büttelamts ein Verwarnungsgeld von bis zu 500 Bromms aufbrumme könnt’? Wahlweis’ od’r bei Nichtzahlung fünf Einheit’n in Verwahrungshaft? He?«
»Schon gut, reg’ dich nicht auf«, beschwichtigte ihn Rouleau, »ich habe ja gar nichts gegen eure Sprache, ich finde sie nur seltsam. Als wäre sie irgendwie völlig falsch abgeschrieben worden.«
Schweigend gingen sie den Schacht hinunter, und Rouleau schien, als wäre Hyazinth weiterhin verstimmt über seine Äußerung.
»Wo habt ihr eigentlich das ganze Zeug herbekommen, das ihr hier verbaut habt?« begehrte Rouleau schließlich zu wissen, obwohl ihn das nur mäßig interessierte und er mit dieser Frage vor allem das jäh abgebrochene Gespräch wieder in Gang bringen wollte.
Hyazinth wandte sich zu ihm um. Seine Miene war nun sehr förmlich, seine Äuglein wie ausgeschaltet.
»All’ die Materialb’schaffung unterliegt der Importgrupp’«, dozierte er. »Das Dornreich Brombonien umfasst zur Stund’ circa fünf Quadratkilometer Fläch’ und breit’ sich ständig aus – über halbvergessen’ Lagerplätz’, Grundstück’ von mittelständisch’n Betrieb’n, über die sich die Erbngmeinschaft’n streit’n; dann wieder uninteressant Land, das die Eigentümer nicht losschlag’n könn’, allweils kein Bauland is’. Über unrentabel’ Acker- und Weidesland, och vernachlässigt Fläch’n aus Kommunalb’sitz. Wir rücke’ dann sofort nach, machen allseits scho’ bestehend’ Heck’n nutzbar und bau’n se aus. Und dann wird das Neuland flugs dem Reich einverleibt. Allweil ganz wichtig sin’ dabei die Streck’nmacher: die schaffens die Verbindungs zwischen den großen Brombeersgebiet’n – indemfolgedessen sie gezielt hier und dort Hecken pflanz’n, oder auch – wenn’s ein’ eilig Affär’ is’ – mal welche implantier’n tun. Ja, so kommts, dass hinwidermal ein Bauer des morgens vor ‘ner doppelmannshoh’n Brombeerheck’n steht und darober ganz scheckig zu werd’n droht, weil da just gestern Abend noch gar überhaupt nichts war. Hi, Hi!«
»Und das funktioniert tatsächlich?« wunderte sich Rouleau.
»Ja, sicher doch. Das sind absolut Spezialist’n, was denkst’n du. Die sorgen dann im anschliessend’n auch für die allzeitig problemlos Begehbarkeit der Weg’ und Abschnitt’, sowie fernerweis und allgemeinhin das reibungslos’ Funktionier’n der Transportinfrastruktur innehalb der ganz Anlag’.«
Dann kratzte er sich nachdenklich an der Backe, wovon diesmal aber keine sichtbaren Partikel abgelöst wurden.
»Weißt Rollo«, sagte er dann nach einer Pause, »vielleicht sollt doch nicht so lang gewart’ werd’n mit de Eingangsformalität’n. Sollt’n gleich zur Preffkturr gehe und gucke ob der Chef scho’ in sei‘ Büro is’, und wenn er’s is’, gleich den Papierkram erledige’ lasse’.«
»Was für einen ›Papierkram‹ denn?«
»Ja, was glaubst’n du was für’n Papierkram denn? Die formal’ Aufnahm’ eb’n! Des offiziell Aufnahmsritual wird ja erst bei der nächst Generalversammelung vollzoge’. Aber bis dothin kannst nich’ wart’n. Brauchst halt’n Papier – als Illegaler kriegst hier nich’ mal ‘ne verdorrt’ Brombeer zugewies’n! Komme mal mit.«
Und damit drehte er sich um und stapfte weiter.
»Aber weißt«, sagte er kurz darauf ohne sich dabei umzudrehen, »eines von unser öffentlich’ Gebäude kann ich dir noch zeig’n unterwegs. Was willst’ sehn: die Zistern’, den Festplatz, das Museum der scheenen Kunst, die Ratt’nfarm?«
»Die Rattenfarm?«
»Gut, die Ratt’nfarm also.«
»Ihr esst … Ratten?«
»Freilich. Und draußen essen’s die Schweins, oder? Ein Fleischbeilag braucht’s halt. Wenn du wiss’n tätst, wie Ratt’nfilets in Brombeersoß’ rodschwaz schmeck’n!«
Und in Gedanken an dieses Gericht krümmte er die Spitzen der braun verkrusteten Finger seiner linken Pfote zusammen, führte sie an seine von Borsten umstandenen Lippen und küsste sie schmatzend.
»Na, komm scho’, Rollo – ‘n klein Imbiss auf unser’ Ratt’nfarm, he?«
»Ein andermal. Zeig’ mir lieber die Zisterne.«
Hyazinth konnte seine Enttäuschung nicht verbergen: »Die Zistern’? … gut, abe’ da is’ nich’ halbsoviel los wie auf ‘er Ratt’nfarm.«
Einige dutzend Meter und zwei Baulampen weiter wandte sich Hyazinth wieder so unerwartet zu Rouleau um, dass dieser die Erde in dessen Gesicht fast schmecken konnte. Dabei fielen ihm die unteren Bereiche von Hyazinthens Augäpfeln auf, die rot geädert waren.
Der Büttel zeigte also hinter sich und rief: »Komm Rollo, da vorn is’ de’ Maktplatz, lass’ uns da mal hingehe!«
Kurz darauf befanden sie sich auf der ungefähren Mitte einer Freifläche, und nachdem sich Hyazinth noch dreimal zappelnd im Kreis gedreht hatte, standen sie dort in den Lichtkegeln von vier Bauscheinwerfern, die sich im Zentrum eines etwa fünfzehn mal zehn Meter großen Platzes vereinigten. Das Areal war selbstverständlich von Brombeerhecken umzingelt, deren Spitzen sich erst in etlichen Metern Höhe auf eine wundersame Weise zu einem durchgehend geschlossenen Dach vereinigten. In der Mitte jeder Seitenlänge mündete ein Schacht auf den Platz und auf Höhe jeweils eines Drittels der Längsachse des Areals stand ein übermannshohes, dickes und rundliches Gebilde – auf einer Seite eines in dunkelrot, gegenüber eines in blauschwarz. Rouleau und Hyazinth standen wiederum in der Mitte zwischen den beiden. Beim Näherkommen an das schwarzblaue Ungetüm sah Rouleau staunend, dass das Gebilde aus einer Vielzahl von kleineren, annähernd gleichgroßen Kugeln bestand, die ihrerseits sich aus ausgeschnittenen Scheiben von schwarzen Holzfurnierplatten unterschiedlichen Durchmessers zusammensetzten. Die rohen Kanten des Presspans waren säuberlich dunkelblau gestrichen worden.
»Ein’s unsr’r Monoment«, sagte Hyazinth mit sichtlichem Stolz. »Ganz gut, wie? Der Künstl’r heisst Zesario un’ is’ scho’ lang spezialisiert auf Kunst im öffentlich’ Raum.«
Da ertönte ein Grunzen das von der Rückseite der monumentalen Riesenbrombeere zu kommen schien. Sofort zog Hyazinth einen kleinen, aber mit besonders furchteinflößenden Dornen besetzten Knüppel unter seinem Fell hervor und nahm eine abwehrbereite Haltung ein.
»Joweedoo?« brüllte er in die Richtung, aus der das Grunzen erschollen war. Und als ihm keine Antwort gegeben wurde, brüllte noch einmal und diesmal lauter: »Joweedoo?«
»Ohnoonoo«, kam es nach einer weiteren Pause kleinlaut hinter dem Monument hervor, »ohnoonoo, gons ruh’g! Nit Gfohrr! Ibinuhii oigschloff.«
Dadurch keineswegs beruhigt ging der Büttel auf Zehenspitzen um die Plastik herum, bis er dahinter spähen konnte. Dann stemmte er die Fäuste in die Seiten und sah verärgert, aber auch erleichtert aus.
»Schoobool!« dröhnte er, »Heiduwidomoo! Oigschloff, ha?«
»Joo, binni oifagh oigschloff«, wimmerte es bestätigend.
»Oigschloff – dasynit lagh! Wyvie Brops gsoffehadu? Eiweiwei, kadunu imicellula waidschloff! Mimikomme!«
Und er verschwand hinter dem Monument, um kurz darauf mit einer spindeldürren, bräunlichen Gestalt von dort wieder hervorzukommen. Der Kopf des Menschen war fast vollständig von schwarzem, strähnigen Haar umwirrt, aus denen eine lange gebogene Nase hervorragte, die ihm etwas Vogelähnliches verlieh, was durch die langen, dünnen Beine und das lose herabhängende Fell noch verstärkt wurde.
Hyazinth bedeutete ihm mit einem kurzen Wink seines Knüppels, dass er vorangehen sollte, und ließ die Waffe dann wieder unter seinem Fell verschwinden. Die Vogelgestalt schwankte anfangs noch ein wenig, doch dann trottete sie brav mit eingezogenen Schultern vorneweg.
»Des is d’r Schoo-Pool«, raunte Hyazinth dem hinter ihm laufenden Rouleau zu, »das war dazumal ‘n begabt’r Presspohndisaign’r und’n geschickt’r Hecknbeschneid’r no’ dozu. Abe’ nu’ … « – und an dieser Stelle umfasste er unter einem bedauernden Augenaufschlag mit einem borstigen Daumen und Zeigefinger ein imaginäres Glas und machte damit mehrere schnelle Kippbewegungen in Richtung seines bartumwucherten, braunkrustigen Mundes – »abe’ nu’ lässt ihn de Brops nimme’ los. Oh, d’r unsel’g Brops! Glücklichweis’ gib’s abe’ nu’ wenig von so Trunkenbold allhie’. Müss’n ihn halt nu noch im Kittche’ abliefern, bevor wir zur Preffkturr gehe.«
Rouleau nickte gleichgültig und befragte sich dabei im Stillen, ob er jetzt nicht auch einen solchen Brops vertragen könnte.
So brachten sie also den Schnapsvogel in das Gefängnis: eine in das Erdreich gegrabene Kammer von vier mal vier Metern, durch deren Mitte – Rouleau verwunderte es nicht mehr weiter – sich ein Gitter aus Ästen eines besonders kräftigen Brombeerstrauches zog. Jenseits davon standen ein Schemel in der bereits beschriebenen Bauart und eine auf vier Baumscheiben gelegte Verschalungsplatte mit Mörtelresten, die offenbar den hierher Verbrachten als Bettstatt dienen musste. Hyazinth ruckelte – nach dem er durch einige routinierte Körperverrenkungen eine kleine Baulampe auf der gegenüberliegenden Wand in Gang gesetzt hatte – eine Gittertür aus Astwerk auf und nickte dann zu Jean-Paul gewandt kurz mit dem Kopf in Richtung der Zelle
»Loosdudoo – noidoo!« befahl er, und schloss die Türe dann wieder hinter ihm. Den Schlüssel des Vorhängeschlosses barg er in Brusthöhe unter seinem Fell.
»Hoydutemponu auminimal vieremalsechse hoirs. Konndu moil gschaid noghpense! Bidonn, Fant Schobool!«
Der Angesprochene hatte inzwischen am Gitter neben der Tür Aufstellung genommen und lehnte bequem die Arme auf die dornigen Äste, aus denen dieses gebildet war. Sein Blick schien unbeteiligt auf die gegenüberliegende Heckenwand gerichtet.
»Bidonn, Fant Hyasind«, sagte er und dabei zuckte das Fell über seinen Schultern ein wenig, »ma plusde noghpense isoo nith xond.«
Draußen zog Hyazinth plötzlich Rouleau in eine gleich neben dem Gefängnis befindliche Öffnung.
»Komme mal mit«, sagte er jovial, »dadrinne’ wohne’ wir nämlich.«
»Juhuu! Kutmork! Issdoooins?« trötete er dann fröhlich in das Erdloch hinein.
Sofort wurde drinnen ein Licht entfacht und Rouleau sah einen Raum, der etwas sechs Meter tief und vier Meter breit war, und der allein die ganze Wohnung auszumachen schien. Eine mit Sackleinen überzogene Sitzgruppe nahm die Mitte des Raumes ein. Die ehemaligen Säcke waren mit dem Schriftzug einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft bedruckt. Neben der Sitzgruppe stand ein Beistelltisch aus kastanienbraunem Furnierholz, aus dessen sauberer Verarbeitung Rouleau auf seine Originalbelassenheit schloss. In einer Ecke aber stand eine Sitzgruppe in fliederfarbenem Furnier, die wiederum ganz in brombonischen Stil gearbeitet war. Tief hinten im Raum befanden sich ein Doppelbett und gleich daneben ein baugleiches, doch viel kleineres Bettchen. Beide Möbel schienen aus den schwarz-weiß karierten Furnierplatten desselben Wohnzimmerschrankes gearbeitet zu sein, was Rouleau an den Beschlägen und Scharnieren zu erkennen glaubte. An den Wänden hingen unterschiedlich große Bilder in Erdfarben, die sich vor allem durch ihre Rahmen aus grünlichen und gelblichen Zaunlatten von der Wand hinter ihnen abhoben. Sobald das Licht angezündet worden war, stürmten von hinten zwei bräunliche Kleinkinder unter lauten, fröhlichen Schreien auf Hyazinth zu, um sich jeweils an ein Bein Hyazinthens zu klammern und ihre Gesichtchen hinter den dortigen Erdschollen zu verbergen.
»Das sin’ Schooklott un’ Schookristoff – unser’ Zwilling!« lachte Hyazinth.
Die Zwillinge, fand Rouleau, sahen aus wie zwei mit Erdkruste überzogene kleine Kartoffeln. Er hatte zweifellos großen Hunger, wie ihm erst jetzt auffiel.
»Und das da is’ mei’ Frau: Serrafien«, schloss der Büttel die Vorstellung seiner Familie ab, »Serrafien – Rollo.«
Auf dieses Stichwort hin setzte sich aus dem hinteren Teil des Raum eine braun bekuttete Gestalt mit kleinen, trippelnden, beinahe tänzelnden Schritten in Bewegung. Sie hielt dabei die Hände vorgestreckt und die dürren Finger weit gespreizt dem Besucher entgegen. Die Frau musste einmal blonde Haare gehabt haben, doch nun waren diese nurmehr ein flachsfarbenes Gestrüpp, das in allen Richtungen von ihrem Haupt in den umliegenden Raum abstand. Mit diesem Haupt aber vollführte sie beim Näherkommen rasche, nickende Bewegungen. Unwillkürlich wich Rouleau zwei Schritte zurück, doch kurz bevor die erdigen, gekrümmten Finger sein Gesicht erreichten, hielt die Frau inne.
»Kutmork, Fant Rollo!« kreischte sie dann spitz.
»Äh, Kutmork, Fantin Séraphine«, antwortete der verschüchtert.
»Wie g’fällds d’r denn allhie?« fragte sie.
Hyazinth streckte sich daraufhin etwas zu Rouleau hinauf und flüsterte: »Wie’s dir gefällt hier, will’se wiss’n. Mei’ Frau is’ nimmer so gut in de’ Fremdsproch.«
»Oh, ich hatte schon verstanden«, antwortete ihm Rouleau. Und zu der Frau gewandt:
»Kut, kut. Donk, donk.«
»Hammernumool royseewolle«, ergriff nun Hyazinth wieder das Wort, »myssenu awr hiezu Preffekdurr. Byshoiomndoo, Schaz.«
Zum Abschied tätschelte er den Zwillingen noch einmal die Kopfborsten und dann wandten sich die Beiden zum Gehen. Kurz vor dem Ausgang machte Hyazinth den ihm Anvertrauten noch auf eine weitere Öffnung in der Wand aufmerksam, die dieser beim Eintreten übersehen hatte.
»Un’ dahinei«, sagte er grinsend, »geht’s zu mei’m Reich.«
»Äh – das Badezimmer?« fragte Rouleau unsicher und mit zweifelndem Blick auf Hyazinthens schollenbehängtes und erdverkrustetes Äußeres.
»Na, Badezimmer!« lachte Hyazinth,»Nix Badzimmer! Da is’ mei’ Atl’ier!«
»Wie – « rief hierauf Rouleau überrascht, »bist denn auch du ein Künstler?«
»Na, was glaubst’n du?« wieherte Hyazinth und schlug ihm gutmütig auf den Rücken, »wie könnt ich’n kei’ Künstl’r sei? Werd’ dir mal bei Gelegenhei’ mei’ Bild’rs zeig’n. Jetz’ müss’ ma’ abe’ weite’.«
Während sie einem weiteren Schacht folgten, der sie, wie Rouleau hoffte, endlich zu jener Präfektur bringen würde, fragte er seinen Vordermann mit schwacher Stimme: »Und was malst du denn so?«
Da drehte sich Hyazinth so rasch zu ihm um, dass sie um Haaresbreite wieder aufeinander geprallt wären, schaute Rouleau tief und ernst in die Augen und hob an: »Ja, was mal ich? – wie oft scho’ hat mich das ein’r g’fragt. Abe’ ka’ ma’ üb’r Mal’rei wirklich rede? – hab ich da’auf jed’smal geantwort’, indem ich z’rückg’frog hob’. No, des muss zwangsläuf’g ei’ hohl G’schwätz bleibe’. Denn entwede’ man sieht Mal’rei – ode’ abe’ man schweigt von ihr. Die Welt der Farb’n is’ nämlich ein’ eig’n Welt, wo kei’ Wort hireiche’ tut.«
»Aha. Und deine Frau, Séraphine – ist die auch Malerin?«
»Ha!« lachte nun der Malerbüttel auf, »die Serafien un Mal’rin! Das Weib kannst jag’n mit Bild’rn. ›Du setz’ dir mit ner tot’n Kunstform auseinand’r, mei’ Lieba‹ sagt’se immermawider zu m’r. Na, die Serrafien hat Installatione macht, Lichtinstallatione un’ so. Ab’r dann kame’ die Zwilling und seitdem arbeitet’se nur noch konzept’ell. So mit Idäen halt – dannemal, wenn die kleine Bälg’r ihr’n Mittagsschlaf halte’. Abe’ die Kind’r komme’ bald inne’ Kind’rgart’n und da will’se dann wieder richtig losleg’n. ›Häghimligh‹ soll ihr erste Installatio heisse’, mit der’se dann wied’r an die brombonisch Öffntlichkeit trete’ will.«
»Häghimligh?«
»Ja, doch: Heg’ im Lichd«
»Ach so. Und dich stört das nicht, wenn deine Frau so geringschätzig von deiner Malerei spricht?«
»Ach weißte, Rollo!« röhrte Hyazinth und knuffte seinen Gegenüber blinzelnd mit dem Ellenbogen in die Seite, »mir g’fällt’s ja, wenn die Frau’n so radikol un’ widersetzlich sin’. Sie is’ ja ansonst’n he’zenslib. Und ich, ich bin ja im Grund’ oogh sehr moderrn g’sinnt un’ aufg’schlosse’. Nu’ in mein’r Kunst, da brauch’ ich halt was inne’ Händ’ – do muss ich Farb’ rieche’, ne Fläch’ vor mir habbe, ‘ne Fläch’, die, wie klei’ sie auch imme’ sei’ mog, doch die ganz Welt bedeut’n könnt – verstehst migh, Rollo?«
»Ja. Äh, und sind denn hier alle – Künstler?«
Hyazinth überlegte einen Moment.
»Nu ja,« sagte er dann, »die Erwachsn’n eigentlich scho’. Abe’ mit de’ Kind’rn, da is’ des scho’ kei’ Selbs’verständlichkeit mehr. Mei’ Schooklott beispielweis’ will mal Bioinjinör aufe’ Ratt’nfarm werd’n.«
Damit beendete Hyazinth dieses informelle Gespräch über das brombonische Kunstgeschehen und das seltsame Paar setzte sich wieder in Bewegung – Hyazinth immer vorneweg, auf dem Fuß gefolgt von Rouleau.
Wiederum einige Baulampen später drehte sich Hyazinth zum wiederholten Male jäh um und stieß dadurch mit seinem Kopf an den Brustkasten des in Gedanken versunkenen Rouleau.
»Da! Da is’ die Preffkturr!« rief er und deutete dabei mit ausladender Geste auf ein aufwendig aus Holzlatten unterschiedlicher Stärke und Farbe zusammengenageltes Portal. Darunter verloren sich drei nebeneinander angeordnete Gänge im Dunkel. Über dem Eingang hing eine gelblich-weiße Küchentischplatte auf die mit roter Farbe die Lettern »Preffkturr« gemalt waren, wobei sich die letzten Buchstaben des Wortes aus Platzgründen stetig verkleinerten. Neben dem Portal befand sich ein aus Furnierholzteilen bestehender Verschlag, in dem ein Pförtner saß, von dem man indessen nur die behaarte Kugel seines Kopfes sah. Zielstrebig baute sich Hyazinth davor auf und röhrte in amtlich-wichtigem Tonfall hinein: »Kutmork, Fant Hybollit! Fant Preffkt schoodaa?«
Ruckartig hob sich daraufhin die Kugel etwas, wodurch zwei trübe Augen darin sichtbar wurden.
»Kutmork, Fant Hyasind,« drang es behäbig nach draußen. »Na, noghnitdoo, makanimmer plus demeure. Kunndu attente voo Burro!«
Dann musterte jener Hypolithe die Kleidung Rouleaus – etwas abschätzig, wie dem erschien – und fragte: »Na, derswoll nyhiee, isser?«
Ohne dem Pförtner zu antworten, zog Hyazinth seinen Schützling in den mittleren der Gänge, nachdem er an dessen Eingang einige Male klatschend in die Luft gesprungen war und damit einmal mehr den Bewegungsmelder eines in dem Gang aufgehängten Bauscheinwerfers ausgelöst hatte.
Schon nach zehn Schritten in dem Stollen gelangten sie an eine Art Tür, die aus in verschiedener Größe ausgesägten Teilen eines Eichenparkettbodens zusammengefügt war. Darüber hing ein Brett aus Mahagonifurnier auf dem in Goldlack »Preffkt« geschrieben worden war. Links und rechts dieser Prachttür standen jeweils zwei orangefarbene Plastikschalenstühle mit Leichtmetallbeinen. Hyazinth forderte Rouleau mit einer knappen Handbewegung auf, in einem der beiden Stühle auf der linken Seite Platz zu nehmen. Gegenüber an der Stollenwand hingen zwei Bilder: eines zeigte in einem spätexpressiven, deutlich an Ensor angelehnten Stil eine bräunliche Blaskapelle auf Bromboniens Marktplatz. Die Musikanten standen großäugig, dickbackig und mit seitwärts gedrehten Füßen zwischen den beiden riesenhaften Brombeeren und wurden von einer entzückten, fratzenhaften Menge brauner Gestalten umtanzt. Auf dem daneben hängenden, deutlich kleineren war eine bläulich-weiß glasierte, ganz mit rotschwarzen Brombeeren gefüllte Keramikschale zu sehen, die auf einem Tisch mit einem weißen Tischtuch mit einer Bordüre aus roten Ornamenten stand. Dieses Bild wiederum war in einem realistischen, klassischen Stil gemalt, wozu sein grober Holzlattenrahmen nicht zu passen schien.
Als Rouleau schließlich das nun einsetzende Schweigen zu ungemütlich wurde, nickte er mit dem Kinn in Richtung des Stillebens:
»Scheeneviev?« mutmaßte er.
»Hhmmja«, brummte der Büttel neben ihm, der offenbar etwas schläfrig geworden war und keine Anstalten machte, das gerade angeknüpfte Gespräch fortzusetzen.
»Und du – malst du auch Bilder mit Brombeeren?« begehrte Rouleau nach einer weiteren Pause zu wissen.
Da wandten sich die funkelnden, überraschten Äuglein Hyazinthens mit einem Mal ihm zu und sein prustendes Lachen ging unvermittelt in ein metallisch schepperndes Husten über.
»Na, Brombeer’n hab’ ich noch nieniech’ jemal’!« antwortete er, nachdem der Hustenanfall vorüber war. »Weißt, ich arbeit’ seit lang’m scho’ üb’r die synthetisch’ Verhältnis’ die verschieden’ Farbmaterial’n mit den jeweilig’n Bildträg’n eingehe. Scho’ drauß’n war das mei’ groß Thema.«
»Aha. Klingt spannend. Und … und was muss man sich unter diesen ›Bildträgern‹ genau vorstellen?«
»Ei, die Bildträge’ halt!« rief der über so vielen fachlichen Unverstand etwas gereizte oder auch nur verblüffte Malerbüttel aus und schlug sich dabei auf die erdigen Oberschenkel, »mich int’ressiert halt das exp’rimentell Prozesshaft’, verstehst’d? Ich mach’ halt so minimol Oingriff’ um die stofflich’ Sublemation zu maximiere’, ne? De’ poetisch’ Reduktionismus hat mi’ scho imm’r fasz’niert. Der kommt auch wied’r – wirst scho’ sehe’. Üb’rnächst Anno mach ich übrign’s ei’ Retrospektiv’ in d’r brombonisch’ Kunstholl – wenn alls klappt.«
Da hörten sie die rasch sich nähernden Schritte eines Menschen der durch die Zähne eine Melodie pfiff, die der von »Le temps des cerises« zumindest ähnelte. Hyazinth federte sofort in die Höhe und nahm eine stramme Haltung ein. Dann forderte er Rouleau mit einem derben Knuff an die Schulter dazu auf, sich ebenfalls zu erheben. Bevor dieser der Aufforderung nachkommen konnte, stand bereits ein kleines, schmächtiges Kerlchen von schwer bestimmbarem Alter vor ihnen. Er trug einen zweireihigen Anzug, dessen Oberfläche mit einem fein verästelten Muster von Rissen überzogen war, die sich in dem grauen, getrockneten Schlamm, mit dem die Kleidung überzogen war, gebildet hatte. Unter einen Arm geklemmt führte er eine Aktentasche aus schwarzem Rindlederimitat mit sich. Es war eine jener Aktentaschen, mit denen in den achtziger Jahren – und wohl auch schon früher – Vereinsfunktionäre zu den jährlichen Mitgliedergeneralversammlungen zu erscheinen pflegten. Zu der kleinen Gestalt des Mannes passte wenig sein kugelig sich unter der Jacke hervor wölbender Bauch; auch sein massiger Kopf, der viel zu groß und schwer erschien, um von den schmalen Schultern darunter dauerhaft aufrecht gehalten zu werden, war auffällig. Der Erdteint seines Gesichtes war deutlich heller als der all jener Brombonier, die Rouleau bisher gesehen hatte. Hinter den Ohren spross jeweils ein Büschel schwarzborstiger Haare in die Höhe, ansonsten war der Kugelkopf kahl. Die hohe Stirn durchliefen horizontale Erdfurchen, die wohl ein Zeichen dafür sein mochten, wie schwer ihr Eigentümer an der Verantwortung seines Amtes trug. Das eigentümlichste an der Gestalt jedoch war die Brille: in dicken, zentimeterweit hervorstehenden schwarzen Kunststoff gefasst, schienen die Gläser aus zwei Objektiven mittlerer Brennweite von handelsüblichen Spiegelreflexkameras zu bestehen, die sogar noch über die Blenden-Mechanismen verfügten, die wohl mittels zweier seitlich an den Bügeln angebrachter Drehknöpfe gesteuert werden konnten. Es war Rouleau im Übrigen ein Rätsel, wie dieses Ungetüm von einer Brillenkonstruktion auf der kleinen Nase des Mannes einen sicheren Halt finden konnte.
»Kutmok! Soi Fant Preffkt!« trompetete Hyazinth dem kleinen Mann entgegen.
»Kutmok aagh, Fant Hyasind«, antwortete ihm der Würdenträger gelassen, holte einen Schlüsselbund aus seiner Aktentasche und machte sich daran, den passenden Schlüssel für das an der Tür befindliche Vorhängeschloss zu suchen.»Duschoodaa?«
»Jowoll, Fant Prrfkt , hoyfryh scho oi Noiuffnaam.«
»Hoymi schoo gpenst. Diesmok ohnkimmy?«
»Frailight, Fant Prrfkt, diesmok. Gley hekimmy simmy.«
»Uus Mazelle kummt?« fragte der Präfekt, der inzwischen das Vorhängeschloss mitsamt der zugehörigen Kette von der Tür gelöst und beides nachlässig in die Sitzschale des neben der Tür befindlichen Stuhles geworfen hatte.
»Joo, frailight, Fant Prrfkt, uus Mazelle.«
»Wie heeser?«
»Rollo heeser, Fant Prrfkt.
»Rollo? Hhm. Oinikumme meteehm.«
Und nachdem der Präfekt hinter den beiden die schwere Parkettboden-Tür wieder zu geruckelt hatte, entzündete er in dem geräumigen Kabinett eine batteriebetriebene Campinglampe, die auf einem Schülerschreibtisch stand. Daraufhin nahm er hinter dem Tisch auf einem Bürosessel, dessen brauner Cordbezug stark abgenutzt war, Platz. Hyazinth und Rouleau setzten sich auf seine Einladung hin auf zwei vor dem Schreibtisch stehende Plastikstühle, wobei sich Hyazinth noch einmal steif und förmlich verbeugte, bevor er Platz nahm.
Sein oberster Vorgesetzter stützte die Ellbogen auf die Tischplatte und legte die Hände übereinander, um darauf sein Kinn zu betten. Dann musterte er den Neuankömmling. Hinter ihm an der Wand hing ein Porträt des Präfekten, das ihn lächelnd, doch in amtlich-steifer Haltung vor einer Brombeerhecke zeigte. Rouleau fand, er sah darauf aus wie eine riesige, grinsende Stubenfliege, was zweifelsohne der mit großer Sorgfalt gemalten Brille zuzuschreiben war, die auf dem Bild noch größer erschien als in Wirklichkeit.
Jetzt drehte der Präfekt an den beiden seitlich der Brillenbügel befindlichen Rädchen, und leise knackend schlossen sich daraufhin synchron die beiden Blendenmechanismen soweit, bis nur noch die Iriden dahinter hervorlugten, die unverhohlen auf Rouleau gerichtet waren. Dieser begann sofort damit, sich unruhig auf seinem Stuhl zu bewegen, gerade so, als könne er damit dem durchdringenden Blick der behördlichen Autorität entrinnen. Eine Rouleau endlos erscheinende Zeit ruhte dieser mechanisch geschärfte Blick schwer auf ihm, bis der Amtsträger endlich durch erneutes Drehen der Rädchen seine Augen wieder bis auf die vorherige Stellung aufblendete und sich erneut Hyazinth zuwandte:
»Wasmoint: Gutmoo dos?«
»Joo, is woll Gutmoo, joojoo.«
»Hhm.«
Plötzlich richtete er zum ersten Male das Wort an Rouleau:
»Leitet Frommatin immer noch das Cantini?« fragte er ihn in einem klaren, kalten Französisch, das Rouleau fast das Blut in den Adern gefrieren ließ.
»Soweit ich informiert bin: – ja, immer noch«, stammelte er schließlich.
»Und macht dann wohl immer noch diese risikolosen, drögen Ausstellungen, die ihm von der Pariser Kunstmafia angedient werden, wie?«
»Äh, dazu kann ich nichts sagen, das entzieht sich – äh …«
»Schon gut! Und Flochel, die alte Schabracke – immer noch die kommunale Kulturbeauftragte, wie?«
»Mme. Flochel, ja … die … immer noch …«
»Tss, tss – syhsd, Fant Hyasind, wyduen allhie nygs dyinfomattien!«
Und Hyazinth lachte emsig und hölzern über den Scherz seines Dienstherren, den Rouleau nicht wirklich verstand.
»Ja, der gute alte Marseiller Filz – auf den kann man sich immer noch verlassen!« fuhr der Prrfkt fort, in dem er sich wieder Rouleau zuwandte.
»Nun sagen Sie mal, Fant Rollo: Schon mal was von einem gewissen Grisson gehört? Geoffroid Grisson?«
»Äh – jaa …«
Rouleau nahm sich nun sehr in Acht.
»La petite train? La Porte d’Aix en rôse … und so weiter. He?«
»Ja, doch, natürlich – das sagt mir etwas … «
Rouleau wusste natürlich genau, wovon der Präfekt so geheimnisvoll und andeutungsweise sprach.
Geoffroid Grisson war jener Idiot gewesen, der damals im Panier-Viertel den Überfall auf jene mit Hartfaserplatten – die mit albernen, provençalischen Motiven bemalt waren – verkleidete, doch grundharmlose Marseiller Bimmelbahn initiierte, bei dem eine Handvoll armer Touristenluder mit Bananen und wohl auch dem ein oder anderen Farbbeutel beworfen wurde. Sie waren darüber so überrascht gewesen wie das liebe, arglose Vieh. Nur wenige Wochen später stattete jener Grisson ein oder auch zwei Dutzend Bengel aus dem Quartier Belsunce mit breiten Tapezierpinseln und rostigen Blecheimern aus, in denen rosa Dispersionsfarbe schwappte. Zusammen mit diesen unbedarften Kindern und einigen Gefolgsleuten machte er sich dann daran, das Pflaster des Boulevard d’Aix hinter der Porte d’Aix ganzflächig rosa zu bepinseln. Seine erklärte Absicht war es gewesen, sich mit seinen Helfern bis ganz hinunter zur Canebière vor zu arbeiten, doch schon nach einer halben Stunde fuhr ein Mannschaftswagen der Polizei vor, in die Grisson und seine erwachsenen Mitstreiter eingeladen wurden. Immerhin hatte man bis zu diesem Zeitpunkt schon etlichen Metern Straßenbelag einen rosafarbenen Anstrich verpasst. Grisson aber kassierte in der Folge – da er nicht in der Lage war, für die Reinigungskosten aufzukommen – einige Wochen Knast. In der Haftanstalt Les Baumettes, in den Hügeln im Südosten gelegen, schrieb er dann einen Essay, eine krude Mischung aus Manifest und Tagebuch, das er »Vers une actionisme libre et seduissante« betitelte und angeblich dem »Nouvel observateur« als »kultur-revolutionäres« Dokument zum Druck anbot, was die Redaktion jedoch höflich doch unmissverständlich ablehnte (wenn Rouleau sich richtig erinnerte, wurde die Schrift dann bei »Cataractes sud« in einer kleinen Auflage gedruckt).
Das Letzte, was man in Marseille von Grisson hörte, war, dass er im Dschungel von Guyana mit einigen Mitglieder seiner Entourage eine große Performance plante, deren Protagonisten die letzten dortigen Ureinwohner sein sollten. Dann verlor sich seine Spur in jenem Urwald und man war in Marseille mancherorts doch recht froh darüber, diese Plage los zu sein.
Doch warum nur interessierte sich nun dieser seltsame brombonische Präfekt hier für jenen fast vergessenen, größenwahnsinnigen Selbstdarsteller mit dem penetranten Sendungsbewusstsein eines Sektenführers?
»Und wie ist es denn nun gegenwärtig bestellt um die Performance-Szene in der schönen Stadt Marseille?« fragte da der dick bebrillte Großköpfige mit unüberhörbar ironischem Unterton.
»Nun ja. …«
»Schon gut! Ich weiß! Es gibt keine mehr!«
Und zu Hyazinth gewandt sagte er in einem weichen, beinahe träumerischen Tonfall: »Waischnogh, Hyasind: La Porte d’Aix en rose?
Dem so Angesprochenen schwamm bereits Flüssigkeit in den Äuglein, sie drohte, die sie umgebenden Erdschichten zu feuchten.
»Oigroodagh! Fant Prrfkt, ointriunff!» rief jener mit einem Beben in der Stimme. »Oonvergesslik – ah, die goidenoldenzighe!«
Rouleau schaute von einem zum anderen. Ihm war, als begänne er, allmählich zu verstehen.
Und verstand auch wieder nicht. Sollte es denn wirklich möglich sein, dass vor langer Zeit im Dschungel von Guyana doch nicht ein Giftpfeil nach einer glücklichen Flugbahn, möglicherweise auch ein philanthropes Giftgetier, diesen höchst unangenehmen Fall von künstlerischer Hybris kurzerhand auf seine unschuldig-kreatürliche Weise gelöst hatte, sondern es jenen Grisson vielmehr auf wundersame Weise in die Brombeerhecken rund um Nancy verschlagen hatte?
Rouleau schwirrte gehörig der Kopf, doch der Prrfkt machte nur eine melancholisch-abwinkende Handbewegung.
»Lassen wir das. Ich spreche jetzt zu Ihnen ausschließlich in der Ausübung meines Amtes als Regierungspräfekt des Dornenreichs Brombonien. Zunächst sollten Sie wissen, dass die Einrichtungen, die Sie heute Morgen in Augenschein nehmen konnten, durchaus nicht schon von jeher bestanden. Damals, in jenen Pionierzeiten, nachdem wir hier anlangten, sah es hier sehr anders aus. Kein Vergleich zu dem Komfort von heute, in dessen Genuss auch Sie bald kommen werden. Aber, mein Bester, schauen Sie doch nicht so bestürzt, es gibt keinen Grund dafür, denn man hat Sie dazu ausersehen, ein weiterer glücklicher Bewohner Bromboniens zu werden. In Bälde werden Ihnen die Bürgerrechte verliehen werden. Sie werden eine Wohnung und eine Arbeit zugewiesen bekommen. Sie werden einen vollgültigen Status haben. Bis dahin sind jedoch noch einige vorbereitende Maßnahmen vonnöten, vor allem bezüglich der weltanschaulichen Eingliederung. Und natürlich werden Sie einen umfassenden, sehr intensiven Sprachkurs in brombonisch absolvieren.«
Äußerlich unbewegt, doch innerlich bebend folgte Rouleau den Ausführungen. Zum ersten Male erkannte er nun in aller Deutlichkeit, dass er im Grunde und ganz offensichtlich keine andere Wahl mehr hatte, als diese ihm vom Präfekten kurz umrissene Zukunft. Sicher, er könnte den Versuch wagen, auch von hier zu entfliehen. Doch wohin? War dies denn nicht bereits der letzte Ort der Zuflucht auf dieser Welt für ihn? Wohin hätte er sich von hier denn noch wenden sollen? Trotzdem sträubte er sich noch, was zum Teil aber auch nur der unüberwindbaren Abneigung geschuldet sein mochte, die er seit seinen Schulzeiten gegenüber Fremdsprachen hegte.
»Sprakgurs – issdass reall notgh?« fragte er also schüchtern an.
Der Präfekt schaute daraufhin fragend auf Hyazinth.
»Wassaghder?«
Der Büttel zuckte entschuldigend und beinahe peinlich berührt die Schultern: »Aughnith verstonn, Fant Prrfkt.«
»Hhm. Sie werden sehen, Rouleau«, fuhr jener also fort, »Sie werden sehen: Man gewöhnt sich sehr schnell an das Leben hier, auch wenn Ihnen zu Anfang noch der eine oder andere Aspekt unseres Alltags fremd erscheinen mag. Sicher, Brombonien mag zwar nicht Marseille sein, und schon gar nicht Paris – doch dafür ist es hier unten auch nicht so hektisch. Im Großen und Ganzen ist das Leben bei uns recht gemütlich. Man muss sich nicht abschuften für ein paar armselige Francs. Die Brombeeren wachsen schließlich von alleine. Und wenn ich auch das kurz andeuten darf: was die brombonische Damenwelt angeht …« – und hier pfiff er etwas unerwartet durch eine Lücke zwischen den Vorderzähnen – » … was soll ich Ihnen sagen; unsere Geburtenrate, die den unangefochtenen Spitzenplatz innerhalb des französischen Staatsterritoriums einnimmt, und unter ungünstigeren wirtschaftlichen Bedingungen sicherlich zu Besorgnis Anlass geben könnte, ist bestimmt nicht allein darauf zurückzuführen, dass es bei uns weder Fernsehen, noch Kino, noch Fußball gibt … Doch genug: es wird Ihnen gefallen! Es hat bis jetzt noch jedem gefallen! Sie werden sich schon sehr bald ein anderes Leben gar nicht mehr vorstellen können.«
Den letzten Ausführungen aber war Rouleau bereits nicht mehr gefolgt, denn da hatte er sich bereits unter zunehmend zwanghaften und hektischer werdenden Bewegungen an den Unterarmen gekratzt. Mit einem Erschaudern hatte er nämlich beobachtet, wie sich im Laufe der Unterhaltung auf seiner Haut, Inseln von kleinen, noch unzusammenhängenden Erdplacken gebildet hatten. Er ruhte daraufhin nicht eher, als bis sie alle nach und nach zur Erde gerieselt waren. Dann zog er die Hosenbeine etwas hoch und begann damit, die Haut seiner Unterschenkel davon zu befreien. Die beiden Brombonier beobachteten ihn dabei ein wenig, schienen sich daraufhin mit stummen Blicken über etwas zu verständigen.
»Sie werden sich an alles gewöhnen«, fuhr der Präfekt schließlich fort. »In den nächsten Tagen werden sie sich weiterhin in unserem kleinen Reich unter Anleitung ausgiebig umsehen, und ich bin mir sicher, es wird Ihnen von Tag zu Tag besser gefallen bei uns. Und ansonsten werden Sie den bewährten Sprachkurs bei unserer Fantin Olga besuchen. In zwei oder drei Wochen halten wir dann die festliche Einbürgerungszeremonie auf brombonisch ab. Und bei der Gelegenheit bekommen Sie dann endlich auch Ihre Urkunde verliehen.«
Da schaute Fant Rouleau auf.
»Was für eine Urkunde?« fragte er tonlos.
Der Präfekt seufzte leise und besah die grauen Spitzen seiner Finger.
»Nun, die Urkunde zu Ihrer Ernennung zum ›Künstler des Monats Juni‹ natürlich«, sagte er dann mit seiner weichen, geduldigen Stimme.
Rouleau fühlte, wie er erbleichte. Und er fühlte darüber hinaus ein durch diesen Vorgang verursachtes Brennen auf seiner Gesichtshaut. Es wurde zweifellos von dem Erdschorf hervorgerufen, der gerade im Begriff stand, sich über seinem Gesicht auszubreiten. Mit den Nägeln seiner Finger begann er daraufhin, über seine Wangen zu kratzen. Wieder rieselte es auf den lachsrosa Velours-Teppichboden zu seinen Füßen. Der höchste brombonische Beamte seufzte ein zweites Mal und warf dann einen Blick auf einen großen, orangefarbenen Wecker, der vor ihm auf dem Tisch stand.
»Nymmerinnmittiim unn kimmerer sic ummen», sagte er daraufhin zu Hyazinth. Dieser erhob sich sofort, zog auch den annähernd paralysierten Rouleau von seinem Stuhl hoch und schob ihn zur Tür.
»Unn basseruff dagher nygs oostell!« rief der Präfekt ihnen noch hinterher, doch da hatten sie bereits das Amtszimmer verlassen.
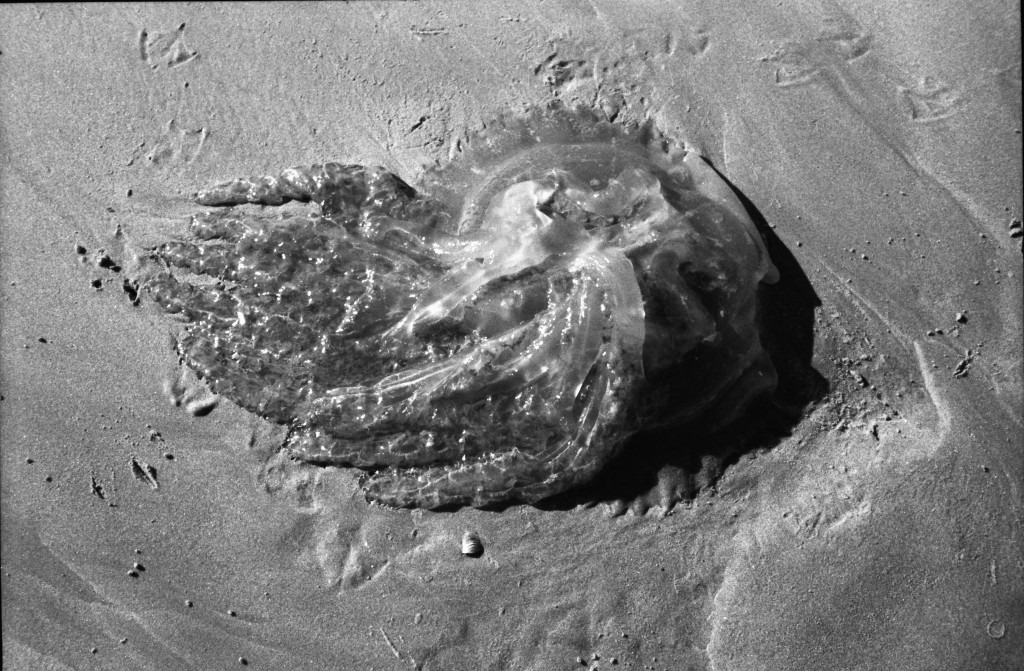
Hotel am Meer
Eine Woche Pauschalurlaub in T.
Darling Publications, 2012
ISBN: 978-3-941765-66-5
Mit den Jahren werden wir uns selber unkenntlich.
Johann Ludwig Tieck (1773 – 1853)

Einleitung und Vorgeschichte
Diese Erzählung ist die Niederschrift eines einwöchigen Pauschalurlaubs zweier Personen, eines Mannes und einer Frau. Man sollte meinen, eine einfache Geschichte: Flug, Transfer zum Hotel, Bezug eines Doppelzimmers, ein erster Strandgang, gefolgt von dem ersten Abendessen im Speisesaal des Hotels, dann die übliche Abendanimation am Pool, am nächsten Morgen das mit Spannung erwartete Frühstücksbuffet, danach wieder Strand, Mittagessen, neuerlicher Strandbesuch am Nachmittag, und so fort. Gegen Ende der Woche noch eine Exkursion zu einer Sehens- oder auch nur Merkwürdigkeit in der näheren Umgebung, endlich der Transfer zum Flughafen und der Rückflug. Um dieses Gerüst könnte sich nun noch ein Kranz von für einen Pauschalurlaub typischen Begebenheiten ranken: partielle Sonnenbrände am ersten Tag aufgrund ungenügend aufgetragener Sonnenschutzcreme, mehr oder minder interessante Strand- und Hotel- bekanntschaften, lärmige Baustellen in der Nachbarschaft, die klassische Schabe in der Duschkabine, unter Umständen eine Quallenplage und Hotelbedienstete, die beteuern, dass es eine solche noch nie hier gegeben hätte; ferner die rituell-folkloristische Übervorteilung durch einheimische Markthändler, die ebenso exotische wie bewegende Lebensgeschichte eines Barkeepers, partnerschaftliche Streitereien und daran anknüpfende Versöhnungen, Eifersüchteleien und eventuell ein von jenen befeuertes Aufflammen alter Leidenschaften, usw.
Doch bereits das Zustandekommen jenes einwöchigen Pauschalurlaubs für zwei Personen, von dem in der Folge die Rede sein wird, war von eher ungewöhnlicher Natur, und sein Chronist kann dem Leser versichern, dass sich im Verlauf dieser Woche keine der oben skizzierten Standard-Vorkommnisse ereignen werden.
Sollte indessen einem Leser der Sinn nach Schilderungen von Begebenheiten just dieser Art stehen, so sei ihm bereits jetzt empfohlen, nicht weiter mit der Lektüre dieses Büchleins fortzufahren, da er unfehlbar enttäuscht werden würde.
Die Kenntnis dieser Geschichte verdankt der Autor (den wir fortan der Einfachheit halber bei seinem Familiennamen nennen wollen) seinem Jugend- und Studienfreund Christoph Helm, der einer ihrer beiden Protagonisten ist. Nach langen Jahren, während derer man lediglich sporadische, annähernd unpersönliche E-Mails mit Einladungen für Konzerte oder Ausstellungen gewechselt hatte, verabredete man sich endlich einmal wieder in einer früheren Szene-Kneipe in Berlin-Mitte (die sich mittlerweile zu einem Anlaufpunkt für Szene-Touristen entwickelt hatte und an jenem Abend auch fast ausschließlich von solchen besucht war). Als Helm nach Fortgang und Verlauf der künstlerischen Karriere Winklers fragte, bekam er eine mehrminütige Klage über die Ungerechtigkeiten und Opportunismen des Kunstmarktes zu hören, die ihm von einem befremdlichen, weil beinahe reflexartigen Charakter schien. Daraufhin war es für eine Weile sehr still an ihrem Tisch inmitten des geräuschvollen Gastraumes. Dann sagte Helm in einfachen, gemessenen Worten, dass, es sich denn so verhielte mit Winkler, dieser dringend ein Projekt, ein Vorhaben, ein eigenes Anliegen finden müsse, welches er mit aller Sorgfalt und Aufmerksamkeit verfolgen müsse. Dies sei die beste und vielleicht sogar einzige Gewährleistung dafür, dass Winkler nicht vollends jener Verhärmung und Misanthropie anheim fiele, die sich in seiner Psyche merklich abzuzeichnen beginne. Ob ihm denn nicht ein lohnendes Projekt einfallen würde? Winkler seufzte und kam dann mit Folgendem: In der Tat habe er vor kurzem ein an orthographischen und grammatikalischen Eigenwilligkeiten reiches Anschreiben des Verlegers Lim erhalten, in dem er eingeladen wurde, ein kleines Buch in dessen Verlag zu publizieren. Das sei doch erfreulich, meinte Helm, – oder gäbe es dabei einen versteckten Haken? Das wohl nicht, Winkler, jener Lim würde unentwegt Künstlerbücher produzieren, wie es schien, vor allem zur eigenen Erbauung. Anschliessend würde er fast jeden, der ihm über den Weg laufe, mit Freiexemplaren derselben beglücken, ganz unabhängig davon, ob der Betreffende Wert auf deren Besitz lege oder nicht. Das sei zwar seltsam, befand Helm, doch keineswegs a priori verdächtig. Durchaus nicht, stimmte Winkler zu. Wo dann also das Problem wäre? begehrte Helm zu wissen.Da sah sich der Verfasser dieser Niederschrift zu dem Eingeständnis genötigt, dass er über keine Idee üge, auf welche Art und mit welchem Inhalt er dies Büchlein hätte füllen können. Wieso er denn eine Idee äuchte, wenn er doch Fotoserienzur Genüge habe, soll er doch irgendeine nehmen und in dem Buch ausbreiten, schlug Helm vor. Er arbeite seit langem nicht mehr in Serien, versetzte Winkler, dieser lammfrommen Folgsamkeit (Klammerinhalt gestrichen)gegenüber scheinbaren Marktgesetzen habe er endgültig abgeschworen. Er sehe keinen Sinn darin, beispielsweise die Strandkörbe der französischen Atlantikküste gewissenhaft abzulichten, nur damit er in Fachkreisen als der Fotograf der Französischen-Atlantikküste-Strandkorb-Serie gälte. Helm wog den Kopf und fand, das könnte indessen doch ein »ganz nettes«Büchlein werden, mit lauter Fotos von den verschieden gestreiften Strandkörben der französischen Atlantikküste darin … Winkler schnaubte kurz und sagte, nein, könnte es nicht, schon weil nur Schwarz-Weiss-Abbildungen dafür vorgesehen seien. Nun, so wäre die Herausforderung für den Fotografen noch größer, da die Fotos umso sublimer geraten müssten, meinte Helm achselzuckend. Da verdrehte Winkler zur Antwort nur die Augen. Es gab für ihn jetzt keinen Zweifel mehr, dass er es hier wieder mit den für Helm typischen kleinen Bosheiten zu tun hatte, die dieser salvenartig von sich zu geben pflegte und die Helm selbst kurioserweise als Freundschaftsbeweise ansah; in dieser Hinsicht hatte er sich also nicht verändert. Nun, sagte Helm, anscheinend gelangweilt, er kenne sich in jenem Metier freilich nicht mehr aus … Nach einer weiteren Pausebeschied er dem überraschten Winkler, dass er ihm aus alter Verbundenheit über die Verlegenheit der Ideenlosigkeit hinweg helfen wolle, indem er ihm die Geschichte eines einwöchigen Pauschalurlaubes, den er vor einiger Zeit mit einer Ex-Freundin verlebt habe, erzählen und zur anschliessenden freien Verwendung überlassen würde. Winkler könne diese Geschichte später niederschreiben, sie mit ein paar Fotos aus seinem Archiv, die mehr oder weniger in den Kontext passten, »aufhübschen« und schon hätte er seine Publikation. Allerdings würde er zwei Bedingungen daran knüpfen, nämlich erstens die Änderung seines Namens und dem seiner Begleiterin, zweitens die Übernahme der abendlichen Zeche durch Winkler. Dieser versprach sich zwar nicht viel von der angekündigten Geschichte, doch hatte er andererseits auch nicht allzu viel zu verlieren (abgesehen von dem gewiss in einem übersichtlichen Rahmen verbleibenden Geldbetrag, den er für die konsumierten Getränke würde entrichten müssen), und so sicherte er beides zu, daran die Frage anknüpfend, unter welchem Namen sein Jugendfreund in dem künftigen Buch figurieren möchte. »Christoph Helm«, jener umgehend, und Winkler hatte weder damals noch späterhin irgendeine Ahnung, wie der Andere so rasch auf diesen Namen verfallen war. Doch war er ganz froh, dass ihm nicht »C.H.«, »S.O.« oder ein ähnliches Kürzel aufgetragen wurde, denn er selbst konnte sich beispielsweise zeitlebens die Marquise von O. nicht anders vorstellen denn als Dame, die unablässig ihren Mund zu kleinen ’s ürze – eine Angewohnheit, die, wie er fand, der Dramatik von Stoff und Figur sehr im Wege stehen und diese sogar ins Lächerliche wenden würde. Was die Urlaubspartnerin Helms anbetrifft, so erfand Winkler für sie später den kuriosen, man könnte gar sagen: kapriziösen Namen »Isaura von Ramsperg«, und auch dessen Herkunft liegt im Dunklen, wiewohl das Vorbild der Figur tatsächlich ein »von« im Namen trägt. Übrigens liegt die Vermutung nahe, dass diese Namenswahl einiges mit Winklers Vorliebe für historische Romane von zweifelhafter literarischer Qualität zu tun haben könnte. –
Nun folgte also die Geschichte des einwöchigen Pauschalurlaubs von »Christoph Helm« und seiner zum Zeitpunkt der Reise schon längstens ehemaligen Freundin und Geliebten »Isaura von Ramsperg« (die der Verfasser fortan gelegentlich mit ihrem ungleich lieblicheren, eleganteren und auch kürzeren Rufnamen »Isa« benennen will). Dieser Aufenthalt fand statt in T., an der n.’chen Küste, im ersten Hotel am Platze, dem Futura Beach Grand Hotel*** . Diese Erzählung sollte den ganzen restlichen Abend füllen und endete erst, als das Personal bereits begonnen hatte, die Stühle umzudrehen und geräuschvoll auf die Nachbartische zu stellen.
Einige Zeit später wurde Winkler von Helm zu dessen unschätzbaren Hilfe eine digitales Tondokument übersandt, das fast alle während der zu schildernden Woche stattgefundenen Gespräche zwischen Christoph Helm und Isaura von Ramsperg enthielt. Nun musste er nur noch die Materialien zusammenfügen und darauf achten, dass er seine literarischen Ambitionen anlässlich der ein oder anderen freien Erfindung oder Ausschmückung, die er sich erlaubte, im Zaume hielt – denn er ahnte, dass diese, wenn er ihnen denn freien Lauf lassen würde, alles verderben könnten; andererseits war ihm durchaus klar, dass ein Autor gelegentlich Gedanken und Empfindungen seiner Protagonisten in Worte zu fassen habe, wenn seiner Geschichte eine plastische Wirklichkeit zu eigen sein sollte.
Der ungewöhnliche Sachverhalt, dass Helm offenbar die Angewohnheit besitzt, Mitschnitte seiner Gespräche anzufertigen, könnte dem Leser bereits jetzt einige Vermutungen bezüglich seines Charakters nahelegen. Um einerseits zu verhindern, dass diese zu sehr ins Kraut schiessen und damit die Geschichte andererseits nicht schon zu diesem frühen Zeitpunkt in den Geruch der Unglaubwürdigkeit gerät, scheint es dem Verfasser angezeigt, Christoph Helm dem Leser mit einigen Worten näherzubringen.
Christophs Elternhaus stand im Zentrum des kleinen Ortes, in dessen Neubauviertel Winkler aufgewachsen war. Sein Familienname war keineswegs »Helm«, auch nicht »Fettel« oder »Ofenloch« – Namen, die dort überaus häufig auftraten (besonders die Zahl der Ofenlochs war angesichts der doch recht kleinen Population erstaunlich). Allerdings besaß er einen dort fast genauso häufig auftretenden Namens von ähnlich rustikalem Klang. Er trug diesen mit einem eigensinnigen, fast trotzigen Stolz, der darauf schliessen liess, dass er insgeheim ein wenig unter ihm litt. Er war ein guter Sohn, allerdings konnte er nie die Vorbehalte die er gegen den Beruf des Vaters – seines Zeichens erster Metzgermeister am Platze – hegte, niederringen, so sehr er sich auch darum bemühte. Es waren dies keineswegs Vorbehalte einer moralisch-ethischen oder weltanschaulichen Natur, sondern vor allem solche von gewissermaßen olfaktorischer, mithin also ästhetischer Art: Christoph konnte den schwülen Geruch des Fleisches, das eben noch Tier gewesen war, nicht ertragen, die blanken Metalltröge, aus denen die Dämpfe der Blut- oder Metzelsuppen stiegen, waren ihm ein Gräuel, und wenn er seinen Vater in einer blutverschmierten weissen Schürze und mit blutigen Händen über den Hof schlurfen sah, wandte er sich unwillkürlich ab. Kurz, er vermochte seinen Erzeuger (der im übrigen ein ausnehmend sanftmütiger Mensch gewesen war) nicht ohne den Metzger zu sehen und umgekehrt, und man muss vermuten, dass Vater und Sohn gleichermaßen darunter litten, wenn sich das auch verschieden äusserte. In der Pubertät angelangt, führte der Junge denn auch die Akne, die nun auf seinem Gesicht in einem solchem Maße aufgeblüht war wie wohl nur selten auf einem jugendlichen Gesicht, umgehend auf seine bis zum Ekel reichende Abneigung gegen das väterliche Handwerk zurück. Seinen Eltern wussten da bereits längst, dass ihr einziges Kind das Geschäft nicht weiterführen würde und dass sie sich (in dieser Hinsicht zumindest) vergeblich abgearbeitet und dabei beachtliche Reichtümer angehäuft hatten. Sie liessen sich nichts anmerken; nur manchmal, wenn der Vater zur Mutter in den Laden kam, um dort die Fleisch- und Wursttheke aufzufüllen, schien sich diese Traurigkeit in einem vielsagenden Schweigen der Eheleute zu äussern. Christoph schauderte insbesondere vor den Lauten, die das ankommende Schlachtvieh oft von sich gab, dem heiseren und irritierten Brüllen und Quieken, den finalen Schreien. Er besorgte sich einen Gehörschutz, wie ihn Bauarbeiter an Kreissägen oder Maschinenführer zu tragen pflegen, und schlief heimlich mit diesem auf dem Kopf, um so zu verhindern, dass er etwa von den morgendlichen Todesschreien des Viehs geweckt würde. Tagsüber übertönte er die Geräusche, die sein hart arbeitender Vater mit seinen Werkzeugen verursachte, mit seinem Plattenspieler, in der Regel handelte es sich bei den Platten um zeittypischen Bombast-Rock. Später entwickelte er eine Vorliebe für die traditionelle indische Musik, schliesslich entdeckte er die europäische Musik vergangener Jahrhunderte. Zum Geburtstag wünschte er sich eine akustische Gitarre, zu Weihnachten eine Staffelei und einen Ölfarbenkasten. Die Eltern, die ihr einziges Kind in stiller Verzweiflung und Hilflosigkeit liebten, erfüllten ihm diese Wünsche. Er hatte nur wenige Freunde, was er vor allem auf seinen Hautausschlag zurückführte. Wenn er nicht Gitarre spielte, hörte er Musik und malte dabei Bilder: kleine, verworrene, surreal-alptraumhafte Szenen, vor denen sich seine Eltern ängstigten. Der alte Helm begann damit, sich ernstlich um seinen Sohn zu sorgen. Die Erleichterung war darum recht groß, als Christoph ein durchschnittliches, doch annehmbares Abiturzeugnis nachhause brachte. Sie hofften auf ein solides Studium (ihnen schwebte Lebensmitteltechnik oder auch Veterinärmedizin vor), doch ihr Sohn bewarb sich ebenso heimlich wie umgehend an der Kunstakademie im nahen F. Die dortigen Kunstprofessoren bewerteten die dunklen, abgründigen Phantasien, die sich in den Arbeitsproben des Aspiranten so drastisch niederschlugen, als vielversprechend und bewilligten daher seine Aufnahme. Heute mag das erstaunen, doch muss man zum Verständnis dieser Einschätzung den damaligen Zeitgeist berücksichtigen: In der wohlsituierten, krisengesicherten, gutbehüteten, doch auch beschaulichen, mitunter sogar biedermeierlich-befriedeten deutschen Bundesrepublik zu Anfang der 1980er Jahre konnte es Intellektuellen und Kunstschaffenden häufig nicht extravertiert genug zugehen und deshalb hegte man u.a. auch eine Vorliebe für manisch-expressive, potentiell gefährdete Charaktere und deren dunkel-dräuende, unheilschwangere Hervorbringungen. Christoph Helm, der einige Monate zuvor dank drei Litern aberwitzig stark aufgebrühten kolumbianischen Bohnenkaffees vom Wehrdienst bis auf Weiteres zurückgestellt worden war, nahm also das Studium der freien und bildenden Kunst an der Kunstakademie von F. auf; es muss dahingestellt bleiben, inwieweit dieser Umstand die Bitterkeit seiner Eltern noch vergrößerte. Ihr Sohn aber öffnete sich der Stadt und der Kunst, diesen beiden für ihn neuen Welten, sowie deren mannigfaltigen Einflüssen auf ein junges Gemüt. Er war so stark mit deren Aufnahme und Verarbeitung beschäftigt, dass er darüber seine Akne und deren Pflege ganz vergaß, woraufhin diese binnen Semesterfrist fast ganz verschwunden war. Seine Farbpalette hellte sich in gleichem Maße auf wie sein Gemütszustand und seine Gesichtsfarbe: er entdeckte die Kunst der Impressionisten, auch Cézanne, Seurat, Bonnard, Matisse. Das düster-depressive Element trat in seinen Bildern immer mehr in den Hintergrund, was seine Akademielehrer mit einer gewissen Missbilligung oder gar Beunruhigung beobachteten. Er wohnte im elften Stock eines Studentenwohnheimes und überschaute von dem Fenster seines kleinen Zimmers aus die ganze Stadt. Nur an wenigen Wochenenden kam er noch nachhause in sein Elternhaus. Zu seinem zwanzigsten Geburtstag liess er sich von seinen Eltern eine Spiegelreflexkamera schenken. Die nötigen fotografischen Grundkenntnisse eignete er sich an einem müßigen Nachmittag an. Seine erste Fotoserie machte er während der Semesterferien in seinem Elternhaus: Über mehr als einen Monat hinweg porträtierte er gründlich und gewissenhaft an jedem Morgen das ankommende Schlachtvieh – Rind für Rind, Schwein für Schwein. Man darf annehmen, dass seine Eltern einmal mehr sehr beunruhigt über das Gebaren ihres Sohnes waren, doch dieser sagte ihnen in einem Ton, als würde mit dieser dürren Auskunft alles zur Genüge erklärt und gerechtfertigt werden, er würde die Aufnahmen »nur fürs Studium« machen. Sie glaubten ihm das nur zu gerne und waren in der Tat erleichtert, denn es sich dabei also um etwas, von dem sie keine Ahnung, doch um so mehr Respekt hatten. Bald war ein Großteil der Wände des Jugendzimmers mit Fotos von großäugigen Kreaturen bedeckt, deren Blicke eine einzige hilflose Frage an eine Welt war, die gleich darauf für sie ein Ende haben würde. Im Unterschied zu Winkler, der einem Jahr nach Helm die Ausbildung an jener Akademie begann, hielt jener jedoch von Beginn an die Fotografie für keine autarke, den anderen künstlerischen Disziplinen gleichrangige Kunstform. Die Porträtfotos dienten ihm lediglich als Vorlagen für altmeisterlich ausgeführte lebensgroße Ölporträts auf Leinwänden, ausnahmslos in dem Format 60 x 60 cm. Immer wurden die Porträtierten im Halbprofil gezeigt. Die Befähigung zu dieser Art von Malerei hatte Helm sich über Monate hinweg in langen Tagen und Nächten in seinem Studentenzimmer anhand einer Reihe von Selbstporträts mit viel Fleiß, Talent und unter Zuhilfenahme von Standardwerken der Maltechnik erworben, die teilweise noch aus dem 19. Jahrhundert datierten und die er sich in den Bibliotheken und Antiquariaten der Stadt besorgt hatte. Er begann mit dem Malen von Rindvieh, da er glaubte, dass seine technischen Fähigkeiten in der für das naturalistische Malen von Schweinen unerlässlichen Ton-in-Ton-Lasurmalerei noch nicht umfassend genug seien. Als er die ersten Ergebnisse der Rinderserie in der Akademie anlässlich einer monatlichen Begutachtung der studentischen Arbeitsproben vorlegte, war das Lehrpersonal entsetzt. Diese ungünstige Aufnahme der Werke hielt Helm jedoch nicht davon ab, ungefähr zwei Dutzend weitere Bilder mit naturalistischen Darstellungen von Rinderköpfen zu malen. Als er die Serie vollendet hatte, ersuchte er bei seinen Eltern um die Erlaubnis, die Bilder in ihrem Metzgerladen auszustellen, ein Anliegen, das sein Vater rundum ablehnte. Der Verwalter des örtlichen Kultur- und Vereinshauses, seines Zeichens Florist und Inhaber des örtlichen Blumenladens, besaß zwar kaum mehr Verständnis hinsichtlich Konzeptualität und malerischer Qualität der Werkgruppe als der Vater des jungen Künstlers, doch sah er das finanzielle Reüssieren des Fleischers mit Missgunst und hegte die Vermutung, dass die Ausstellung mit dem Titel »Die toten Rinder – Porträtmalerei von Christoph Helm« sich nicht gerade geschäftsfördernd für den alten Helm auswirken würde. Diese Ahnung wurde am Abend der feierlichen Ausstellungseröffnung zur Gewissheit: Die wenigen Besucher zeigten sich so schockiert, wie sie es wohl nicht einmal infolge eines skandalösen Fernsehfilmes gewesen wären. Sogar der Bürgermeister verweigerte das angekündigte Grusswort und ging verärgert ab. Der junge Künstler verstand das nicht, entschied sich aber schließlich dafür, die Ablehnung, die seinen Bildern entgegenschlug, auf ein begrenztes Kunstverständnis und einen dem seinen entgegengesetzten Schönheitsbegriff des kleinstädtischen Publikums zurückzuführen, das in der Kunst immer nur ein abgeschmackt und berechnend transzendiertes Idyll suchte, nach welchem es in der Wirklichkeit ein Leben lang umsonst gestrebt hatte. Übrigens kam es nicht mehr zu der für das Folgejahr geplanten Fortsetzung der Ausstellung, die den Titel »Die toten Schweine – Portraitmalerei von Christoph Helm, Teil II« hatte tragen sollen. Doch schon die Präsentation der Rinderserie war Anlass genug, dass es zu einem langjährigen Zerwürfnis zwischen Vater und Sohn kam, das erst kurz vor dem frühen Tod des Metzgermeisters beigelegt werden konnte. Ungleich stärker als den Misserfolg in der Heimatgemeinde traf Helm jedoch jener anlässlich der Zwischenprüfung an der f.’schen Akademie. Dort musste er notgedrungen seine Kuh- und Ochsenköpfe präsentieren, da deren minutiöse Darstellung ihn in jenem Studienjahr zeitlich so in Anspruch genommen hatte, dass er keine Zeit erübrigen gekonnt hatte, um nebenbei einige andere Arbeiten anzufertigen, die – wie immer diese auch ausgefallen wären – auf alle Fälleschon eher dem ohnehin nicht gerade wählerischen Zeitgeschmack nahegekommen wären. Er besaß in dieser Sache durchaus ein ungutes Vorgefühl; andererseits spricht vieles dafür, dass auch hier wieder seine schon seit Kinderjahren sich herausbildende Eigensinnigkeit die Oberhand behalten hatte: denn zweifellos wäre es ihm leicht gefallen, binnen eines Tages, einer Nacht gar, einige feingespinstige Linien auf ansonsten jungfräulich bleibende, weisse Papierbögen zu werfen. Seine Prüfer aber hätten dann sicher – wenn sie die Arbeiten nicht gleich als »recht interessanten Ansatz« begrüsst hätten – den Studenten Helm immerhin auf dem Wege der Besserung, da dem Gift des Akademismus entsagend, gewähnt und ihn daher wohlwollend in das nächste Studienjahr durchgewunken. Doch mitnichten: Christoph Helm rückte mit seinen vollständigen Rindviechern an, hing diese an der ihm zugewiesenen Wand in Reih und Glied auf und harrte dann dem Scherbengericht, das über ihn hereinbrechen sollte. Und es kam über ihn. Selbst ein Vierteljahrhundert später noch muss man sich darüber wundern, mit welcher Zielsicherheit dieser junge und in vielerlei Hinsicht noch naive Mensch es damals vermocht hatte, sich in einem eigentlich durch und durch permissiv und pluralistisch erscheinenden Milieu zwischen allen Stühlen zu platzieren und sich in ein vollkommenes künstlerisches Abseits zu befördern.

Dabei bestand das Prüfungsgremium aus Professoren, die eigentlich grundgutmütig waren, andererseits aber auch genügend pädagogische Weitsicht besaßen, um die Notwendigkeit zu sehen, dass sie in diesem besonderen Fall ein Exempel zu statuieren hatten. Also brummten sie Helm ein sogenanntes »doppeltes Probesemester« auf. Dieses sollte – wie der Vorsitzende des Gremiums erläuterte – der Student vor allem zum Nachdenken und zur Einkehr nutzen. Beabsichtige er allerdings nach Ablauf eines Jahres wiederum solch abgeschmackte Arbeitsproben vorzulegen, so lege er dem Studenten Helm bereits jetzt nahe, sich schon mal nach einer für ihn geeigneteren Akademie umzusehen, – »vielleicht ja irgendwo im großen Sowjetreich«. Helm liess sich das nicht zweimal sagen und exmatrikulierte sich bereits am darauf folgenden Tag von der Akademie in F., ging allerdings nicht in die ihm anempfohlene Sowjetunion, sondern nach H., wo er über einige Zeit hinweg erfolglos Anschluss an Künstlerkreise suchte. Stattdessen fand er eine Anstellung in einer Bilderrahmenwerkstatt, deren Besitzer ihm nach Ablauf seiner Aushilfstätigkeit eine Lehrstelle als Tischler vermittelte. Als nach drei Jahren die Gesellenprüfung bevorstand, riet ihm sein Meister, als Gesellenstück ein Sideboard oder ein ähnliches Kleinmöbel zu bauen, da ein solches bei den Innungsprüfern stets gut ankäme. Der Lehrling fertigte stattdessen eine trapezförmige Konzert- gitarre aus Mahagoni- und Ebenholz an. In einem späteren Gespräch äusserte er die Überzeugung, dass er erst in jenem Moment, in dem er sich zu dem Bau dieses kuriosen Musikinstrumentes entschlossen habe, »der Kunst oder dem, was allgemein als solche bezeichnet wird, endgültig von der Fahne gegangen« sei. Das Prüfstück versetzte die Jury in Erstaunen, allerdings auch in eine gewisse Ratlosigkeit. Immerhin bestand er dieses Mal die Prüfung, sogar mit Auszeichnung (wenn diese auch vor allem jener Ratlosigkeit geschuldet gewesen sein mochte). Der Geselle Helm war indessen unzufrieden mit den klanglichen Eigenschaften seines Instrumentes und noch in späteren Jahren, als aus ihm längst ein gefragter Meister geworden war, pflegte er es unter den immer gleichen Scherzen von der Wand seiner Werkstatt zu nehmen um Besuchern mit einigen Akkorden zu demonstrieren, wie ein Saiteninstrument nicht klingen sollte.
Im Anschluss an die Tischlerlehre trat Helm in ein unbefristetes Praktikum bei einem Cello- und Gambenbauer ein, der zurückgezogen auf einem halbverfallenen ehemaligen Bauernhof auf dem Lande lebte. Jener musste ein sonderbarer alter Kauz gewesen sein, und als Helm einmal bei einem seiner seltenen Besuche in H. gefragt wurde, wie er es mit diesem Menschen dort so lange aushalten könnte, zuckte der die Schultern und sagte bloß, sie würden beide dasselbe Ziel verfolgen, was ihm Grund genug wäre zum Bleiben. Er blieb tatsächlich mehrere Jahre bei dem Alten, der im Laufe dieser Zeit immer sonderlicher wurde. Ihr gemeinsames Ziel aber, das Erreichen eines wenn schon nicht vollkommenen, so doch der Vollkommenheit sehr nahekommenden Saitenklangs, sollte das kuriose Paar nicht erreichen. Eines Tages schickte der Alte seinen Schüler mit der Bemerkung fort, er habe nichts mehr, was er ihm beibringen könnte. Im Übrigen würde er sich schon seit geraumer Zeit von Helms Anwesenheit gestört fühlen, schlussendlich könne er es auch nicht mehr ertragen, dass Helm einen notorisch fahrlässigen Gebrauch der kostbaren Werkzeuge und Maschinen betreibe. So ging Helm nach einem auf immer währenden und dennoch äusserst trockenen Abschied nach P., wo er eine aufgegebene Tischlerwerkstatt anmietete, sich sodann die nötigen Maschinen, Werkzeuge und Hölzer besorgte, um anschließend innerhalb von wenigen Jahren zu einem der in Fachkreisen gefragtesten Baumeister für Celli und Gamben landesweit zu werden.
Es war kurz nach seiner Niederlassung in P., als Winkler den engeren und regelmäßigen Kontakt zu seinem Jugend- und Studienfreund verlor und von diesen Zeilen an befindet sich der Leser deshalb in den Schilderungen und Auskünften, die Helm an jenem Abend in Berlin-Mitte machte.
Isaura von Ramsperg und Christoph Helm lernten sich demnach bei einem Kurs für Cellobogen-Bau kennen. Helm hatte sich dazu entschlossen, auch noch dieses Handwerk zu erlernen, da es seiner Überzeugung nach für jedes von ihm gebaute Instrument nur einen einzigen, individuell für dieses konzipierten Bogen geben könne. Isaura von Ramsperg hingegen hatte im vorvergangenen Jahr (nachdem sie wieder einmal nicht ihrer Nervosität vor Konzerten Herrin geworden war und deshalb, weit unterhalb ihrer eigentlichen Fähigkeiten bleibend, bereits in der Vorrunde des international renommiertesten Wettbewerbes für Cellisten ausgeschieden war) die Entscheidung getroffen, von dem aufgrund ihres Talentes eigentlich vorgezeichneten Berufsweges als professionelle Musikerin abzusehen und sich stattdessen dem Handwerk der Fertigung ihres Instrumentes zu widmen. Zuerst teilten die beiden nur Helms Werkstatt in P., kurz darauf auch Tisch und Bett. Die Beziehung hielt einige Jahre, obwohl schon zu ihrem Beginn im Grunde für beide abzusehen war, dass sie nicht von Dauer sein könne. Dieses von ihren Empfindungen füreinander unbeeinflusste Bewusstsein der Unmöglichkeit (die beiden in ihrer Unabdingbarkeit fast wie ein über sie verhängtes Verdikt von metaphysischer Natur erschien), war wohl ein Hauptgrund dafür, dass sich in der Folge eine ebenso schmerzliche wie intensive Liebesbeziehung entwickelte. Ab einem gewissen Zeitpunkt besaßen sie jedoch nur noch diese Geschichte und deren so rätselhafte, wie quälende Implikationen, an denen sie auf verschiedene Arten trugen, an denen sie aber auch in befremdlicher Weise festhielten. Ohnehin hatten sie da schon seit einiger Zeit ihr eigenes Wohlergehen sowie das des anderen aus den Augen verloren. Oder wie Helm es noch lange nach der Trennung mit einer seltsamen Mischung aus Sarkasmus und Dramatik zu umschreiben pflegte: Einer sei durch den anderen hindurch gegangen und sehr wenig sei nach diesem Durchgang von ihnen übrig geblieben. Das mochte vielleicht nur die Mystifizierung einer im Grunde wenig ungewöhnlichen Geschichte gewesen sein, die fast jeder so oder so ähnlich bereits erlebt haben mag, doch soll keinesfalls in Abrede gestellt werden, dass die Spuren dieser Erfahrung sich tief in ihre Seelen eingruben. Beide kostete es danach einige Mühe, sich mittels neuer Beziehungen, Reisen, moderaten Abenteuern, ihrer Arbeit und natürlich der lindernden, elementaren Wirkkraft der Zeit einigermaßen wiederzufinden. Doch auch noch viel später erschien jedem von ihnen die Sache hartnäckig im Bereich des Enigmatischen zu verbleiben, und es fiel ihnen auch im Nachhinein kein einziger plausibler Grund ein, warum ihrer Verbindung kein Bestand gegönnt gewesen war. Helm ging neue Partnerschaften ein, die mitunter von fast tragikomischer Kürze waren. Freimütig räumte er ein, dass ein Hauptgrund dafür in dem Umstand zu suchen sei, dass er Zeit, Kraft und Aufmerksamkeit in stetig zunehmendem Maße auf seine Arbeit fokussierte. Immer mehr wurden ihm die eremitischen Abenteuer in der Abgeschiedenheit seiner Werkstatt, in den stillen Musikbibliotheken Europas, zu Lebenssinn und -inhalt. Doch zu Mitte des ersten Jahrzehntes des neuen Jahrtausends begann in ihm ohne ersichtlichen Anlass ein Gefühl Raum zu greifen, das er nach anfänglicher Verwirrung und daran anschliessender Introspektion als Weltverlust identifizierte. Etwas in seinem kognitiven System hatte erkannt, dass die Zeit, in der er lebte, eine ungeheuere Fahrt aufgenommen hatte und er im Begriff stand, auf der Strecke zu bleiben. Er begann, sich für die digitalen Technologien zu interessieren, eignete sich Kenntnisse an, experimentierte mit den avanciertesten Aufnahmetechniken, beteiligte sich sogar an sozialen Netzwerken. Erst Jahre später wurde ihm klar, dass die Ursache für seine plötzlichen Anstrengungen auf diesem Gebiet die Furcht vor der existentiellen Einsamkeit, in der er lebte, gewesen sein musste.
Isaura von Ramspergs Lebensfaden spann sich in eine gänzlich andere Richtung fort. Sie heiratete etliche Jahre nach der Trennung von Helm in K. einen Professor für Musikpädagogik und wurde Mutter einer Tochter. Ihre kleine Werkstatt vermietete sie befristet unter, doch sollte sie nie mehr in sie zurückkehren. Erst ein Jahrzehnt später richtete sie sich in der Waschküche ihres Hauses wieder einen Arbeitsraum ein – nur um festzustellen, dass sie nicht nur einen Großteil ihrer früheren Fähigkeiten, sondern auch das Gefühl für die Materialien, die sie formen und zum Erklingen bringen wollte, verloren hatte. Ihre Ehe verlief harmonisch, die Tochter sollte allerdings das einzige aus ihr hervorgehende Kind bleiben. Sie widmete sich diesem mit all ihrer Aufmerksamkeit und Liebe. Als die Tochter ungefähr vierzehn Jahre alt war, das Gymnasium besuchte und begann, ihre eigene Wege zu gehen, fragte sich Isa eines Tages, was sie nun mit ihrem Leben noch anfangen könnte. Eine befreundete Nachbarin führte sie daraufhin in die ehrenamtliche Sozialarbeit einer evangelischen Gemeinde ein. Zusammen organisierten sie Veranstaltungen für Senioren. Zur selben Zeit begann sie ihr Cellospiel, dass sie nie ganz aufgegeben hatte, wieder zu intensivieren. Eines Tages spielte sie auf einem Seniorennachmittags ein paar Stücke und erzählte dabei in einfachen Worten einiges über die Komponisten, ihre Musik und ihre Lebensgeschichte. Die Alten waren hingerissen, und Isa fand selbst, dass dies das beste Konzert gewesen war, das sie jemals gegeben hatte. Von nun an fanden diese Konzerte regelmäßig statt, wodurch sie gezwungen war, sich ein breiteres Repertoire zu erarbeiten. Die Tochter studierte bereits in M. im vierten Semester Kultur-Management, als sich Isaura von Ramsperg und ihr Mann, der Professor für Musikpädagogik, einvernehmlich trennten. Auch in diesem Trennungsfall war ein einleuchtender Grund nicht ersichtlich, einmal mehr schien Isa eine ebenso unergründbare wie unabdingbare Notwendigkeit am Werk gewesen zu sein. Im Unterschied jedoch zu der über zwei Jahrzehnte zurückliegenden Trennung von Christoph Helm war das nun in ihr vorherrschende Gefühl nicht etwa Schmerz oder Ohnmacht, sondern Ermüdung, überdies auch eine sie befremdende Erleichterung. Inzwischen erhielt sie aus allen Landesteilen und von den verschiedensten Institutionen Einladungen für Seniorenkonzerte; mit deren moderaten Gagen vermochte sie ihren ohnehin wenig aufwendigen Lebensunterhalt ganz gut zu bestreiten. Es fiel ihr deshalb leicht, auf Unterhaltszahlungen ihres Ex-Ehemannes zu verzichten, der im Gegenzug die nicht unbeträchtlichen Kosten für das Studium und die internationalen Praktika der Tochter alleine bestritt. Zu jener Zeit, als Isaura von Ramsperg die beiden E-Mails von Helm bei einer Routine-Kontrolle aus dem Spam-Ordner ihres Website-Accounts fischte, hatte sie gerade beschlossen, sich in den kommenden zwei oder drei Wochen von den Anstrengungen der Konzerte der zurückliegenden Monate zu erholen.
Zu Anfang der zehner Jahre des 21. Jahrhunderts tätigte Christoph Helm in P. am Ende einer sich bis in die frühen Morgenstunden erstreckenden Sitzung am Computer (nachdem er zuvor einige lange aufgeschobene Verwaltungsarbeiten sowie den angefallenen elektronischen Schriftverkehr erledigt hatte) zu seiner eigenen Überraschung eine Online-Buchung für einen einwöchigen Pauschalurlaub in T. – Ihm war bisher so etwas niemals in den Sinn gekommen und er konnte sich die Tatsache, dass er es nun offenbar getan hatte, nur mit dem Umstand seiner Übermüdung, allenfalls noch mit einer ihm ebenfalls völlig irrational erscheinenden Verlockung durch das selbst für die Nachsaison äusserst günstige Angebot des Veranstalters erklären. Zunächst war es ihm nicht gelungen, die Buchung durchzuführen, obwohl er bereits mehrmals den Cursor auf den mit »bestätigen« überschriebenen Button gerichtet und die Enter-Taste gedrückt hatte. Als er daraufhin noch einmal alle Punkte der Anmeldung durchging, entdeckte er eine nunmehr rot umrahmte Eingabe-Maske mit der Aufforderung, den Namen und die Anschrift des Reisepartners einzutragen. Es handelte sich also sogar um eine Reise für zwei Personen, das war ihm bisher entgangen. Ungläubig starrte er noch einmal auf die Endsumme, die ihm nunmehr von einer geradezu fabelhaften Geringfügigkeit erschien. Eine Weile saß er unbeweglich vor dem Bildschirm, nur seine Daumenkuppen kreisten über denen der Zeigefinger. Schließlich öffnete er ein neues Browser-Fenster, fand mithilfe der Suchmaschine binnen Sekunden zu Isaura von Ramspergs Website und wählte dort die Rubrik »Kontakt«, wo er tatsächlich das Gesuchte umgehend fand. Er markierte die Zeilen, um sie anschliessend mit der entsprechenden Tastenkombination in der Zwischenablage zu speichern, und minimierte sodann jenes Fenster, um die Information, bei der es sich um die postalische Adresse der Website-Betreiberin handelte, in das entsprechende Feld der Reiseanmeldung zu kopieren. Endlich scrollte er nach unten, um ein zweites Mal jenen Button zu aktivieren, auf dem das verbindliche, ja ihm nun bedrohlich scheinendeVerb »bestätigen« prangte. Diesmal führte das Programm die Reservierung durch. Alle diese Schritte hatte er fast mechanisch durchgeführt, sie waren ihm leicht und sicher von der Hand gegangen. Nun aber starrte er auf den Bildschirm, als könne er nicht ganz glauben, was er da gerade eben getan hatte (er, der Urlaube eigentlich gar nicht mochte). Er klickte einige Schritte zurück, bis er die Angebotsbeschreibung des Veranstalters wiederfand, kopierte daraus die Rahmendaten der Reise in die Zwischenablage, öffnete das minimierte Fenster mit Isaura von Ramspergs Website wieder und fügte in der in der Sparte »Kontakt« hinterlegten Maske die kopierten Informationen der gebuchten Reise ein, sowie die daran anknüpfende Frage in Kurzform, ob sie »vielleicht Lust« hätte, ihn zu begleiten. Danach aktivierte er den mit »Nachricht senden« überschriebenen Button. Das alles hatte kaum länger als eine Minute gedauert. Daraufhin saß Christoph Helm reglos in seinem fast dunklen Büro vor dem hell leuchtenden Computer-Bildschirm und war bestürzt. Nichts konnte das, was er gerade getan hatte, ungeschehen machen. Von der gebuchten Reise hätte er noch zurücktreten können, notfalls hätte er sie sicherlich auch alleine antreten können, doch gab es keine Möglichkeit, die von ihm soeben abgesandte Mail an Isaura von Ramsperg zu widerrufen. Allenfalls hätte er noch hoffen können, dass sie unentdeckt im Spam-Ordner des Accounts verbleiben und bei der nächsten Kontrolle von der Empfängerin übersehen und endgültig gelöscht werden könnte. Doch das erschien ihm unwahrscheinlich. Ein auf der Höhe der Zeit operierendes E-Mail-Programm würde vielmehr seine Mail in den Unbekannt-Ordner sortieren, was ihre unweigerliche Auffindung zur Folge hätte.
Von gemeinsamen Bekannten hatte Helm vor langer Zeit schon erfahren, dass Isaura von Ramsperg allem äusseren Anschein nach glücklich verheiratet sei und eine Tochter habe, die nach seiner Schätzung nun wohl um die dreizehn oder vierzehn Jahre alt sein mochte. Es war nicht ausgeschlossen, eher sogar wahrscheinlich, dass sie inzwischen noch weitere Kinder bekommen hatte. Dies alles kam ihm nun in den Sinn, und er schämte sich daraufhin noch mehr der unbedachten Dummheit, die er begangen hatte, zieh sich auch eines verantwortungslosen Verhaltens. Also kehrte er zu Isaura von Ramspergs Website zurück, um erneut ein Schriftfeld zu füllen. Es war klein und er vermochte kaum den jeweils vorangegangenen Satz innerhalb seines Rahmens überblicken, was das Schreiben nicht leichter für ihn machte. Umständlich und wortreich erklärte er, wie es zu dem vorigen Anschreiben gekommen war, bat um Entschuldigung und versicherte, dass er keine Antwort auf seinen dummen, unüberlegten Schritt erwarte; ein Ignorieren sei ohnehin wohl die angemessenste Reaktion. Doch da kam er erneut ins Grübeln, rang wieder mit sich und fügte hinzu, dass sie die obigen Zeilen (die er selbst längst nicht mehr sah) allerdings auch nicht dahingehend missverstehen solle, dass er seine nun einmal ausgesprochene Einladung zurücknehmen wolle. Sollte sie sich also entgegen aller Wahrscheinlichkeit zu dem genannten Zeitpunkt vor dem Schalter im Flughafen von S. einfinden, so werde er sich selbstverständlich darüber freuen. Daraufhin schickte er das elektronische Schreiben ab.
Am nächsten Tag wachte er benommen wie nach einem Rausch auf. Er suchte bereits auf der Website des Reiseveranstalters nach einem Weg, um die gebuchte Reise nach T. zu stornieren, als ihm klar wurde, dass diese Option nach seinen E-Mails an Isaura ohnehin nicht mehr bestünde.
In der Nacht vor Antritt des Kurzurlaubs schlief er kaum; lange erwog er die Möglichkeit, in den frühen Morgenstunden vorsätzlich den Zug zu verpassen, der ihn nach S. bringen sollte.
Als Christoph Helm und Isaura von Ramsperg sich nach fast einem Vierteljahrhundert auf dem Flughafen von S. wieder begegneten, erkannte zuerst einer den anderen nur zögerlich. Helm wunderte sich da über das Wirken der Zeit, die, obzwar sie augenscheinlich so überaus mächtig, doch so nachsichtig eingerichtet war, dass er ihre Spuren an sich selbst, an seinem eigenen Gesicht und seinem Körper, bisher nicht annähernd so unerbittlich wahrzunehmen vermocht hatte wie nun an seinem Gegenüber. Als sie später im Flugzeug nebeneinander saßen und die Maschine unmittelbar nach dem Start in geringer Höhe den Luftraum zwischen zwei Flughafengebäuden passierte, erwog Helm in scherzhaftem Ton die Möglichkeit der Existenz einer mathematischen Formel, die – je nach Anzahl von Flugreisen einer Person – eine einigermaßen verbindliche Auskunft darüber geben könne, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass diese in einem Flugzeug einmal einen Unfall erleiden werde. Isaura von Ramsperg lächelte daraufhin nur gezwungen, und auch in der Folge schien es fast so, als würde es sich bei ihnen um zwei zufällig nebeneinander sitzende Passagiere handeln, die in einer steifen Manier versuchten, ein Gespräch anzuknüpfen. Nicht zuletzt deshalb nahm das Gefühl der Fremdheit und des Befremdens in ihnen überhand. Während der letzten halben Stunde der Flugzeit schwiegen sie schliesslich ganz.

Hotel am Meer
I.
Das Hotel, in dem die beiden Pauschalurlauber am frühen Abend der örtlichen Zeit eintrafen, war eine senkrecht in den Himmel ragende graue Wand, ein hoher Quader von nur etwa fünfzehn Metern Tiefe. Es befand sich in der Nähe einer Küste, die man in früheren Zeiten als »Gestade« bezeichnet hätte, womöglich mit dem romantischen, wenngleich bedrohlich anmutenden Attribut »dunkel« versehen. Das Gebäude, obgleich es, wie die beiden Neuankömmlinge vermuteten, höchstens aus den 1980er Jahren datierte, erschien Isa wie eine Gesetzestafel, die ein Riese dort in vorgeschichtlicher Zeit aufgestellt hatte. Der Haupteingang des Hotels befand sich an der von der Küste abgewandten Seite. Die Hotellobby war mit einer Menge schwerer brauner Polstermöbel gefüllt, auf denen bei ihrer Ankunft niemand saß. Gemeinsam mit dem dunkelgrünen Teppichboden wirkten sie wie eine Nachahmung jener bemoosten Felsen, die in großer Zahl auf der rückwärtigen Seite des Hotels in einer sandigen Ebene vor dem Strand verstreut lagen. An den holzgetäfelten Wänden hingen vielarmige elektrische Leuchter aus Kupfer und unechten Kristallen. Auch gab es eine große Zahl von in breite, goldfarbene Rahmen gefasste Spiegel unterschiedlicher Größe und Form. Es hielten sich nur einige grau livrierte Hotelbedienstete in dem Raum auf. Wenn diese nicht gerade von notwendigen Verrichtungen in Anspruch genommen waren, standen sie sehr aufrecht irgendwo in dem weitläufigen Raum und schauten geradeaus. Isa beobachtete sie dabei eingehend von ihrem Platz aus und wähnte sie daraufhin in einer Art von träumenden Stand-By-Modus; Helm hingegen fühlte sich schlicht an Erdmännchen erinnert.
Während zwei Hoteldiener die Koffer der neuen Gäste auf deren Zimmer brachten, hatten diese sich in zwei Sesseln niedergelassen, Helm mit einem Kristallglas, das eine ihm bis dato unbekannte, offenbar landestypische Spirituose enthielt, von Ramsperg mit einem Glas Rotwein von ebenfalls einheimischer Herkunft. Sie berichteten einander zögerlich von ihrem Leben während der letzten zweieinhalb Jahrzehnte, und sie taten das ohne rechte Überzeugung, ganz so wie Leute, die nur zu gut um die Unzulänglichkeit der dafür gebrauchten Worte wissen, die – gleichgültig wie wohlerwogen sie auch immer sein mochten – keinen wirklichen Eindruck von dem zu geben vermochten, was dem Sprecher in der Vergangenheit widerfahren war. Obzwar sie sich bemühten, ihren Schilderungen Lebendigkeit und Anschaulichkeit zu geben, so spürten sie doch schon während des Verfertigens der Sätze überdeutlich das Scherenschnitthafte und Papierne, das ihre Worte in ihrer Gesamtheit ergaben. Insbesondere Christoph Helms Auskünfte über sich wirkten auf Isa, als würde er sich darum bemühen, ein amtliches Formular mit grösstmöglicher Gewissenhaftigkeit auszufüllen. Das mochte auch der Grund dafür gewesen sein, dass sie schon bald damit begann, häufiger an ihrem Glas zu nippen, sich umzusehen und dabei irgendeinen Gegenstand ins Auge zu fassen, oder mit einem scheinbar amüsiertem, doch auch rat- und hilflosem Lächeln einige dunkle Flecke auf dem Teppichboden vor sich zu mustern. Dieses Gebaren könnte indessen auch mit Überlegungen zu tun gehabt haben, die sie während Helms Ausführungen, denen sie nur noch zerstreut folgte, über ihre eigene Gegenwart, und konkret über die Situation, in der sie sich befand, anstellte. Es könnte ihr zumute gewesen sein, wie zu Anfang eines Traumes, wenn der Träumende noch nicht zu erfühlen vermag, in welche Richtung sich sein Traum bewegen wird – ob in eine gute oder doch eher schlimme – und er, der Träumer, sich selbst im Traum diese Frage vorlegt, obschon er genau weiß, dass er dies nur ergründen kann, indem er weiter träumt. Schliesslich wurden die Gesprächspausen wieder länger, und während Isa diese ebenfalls wie Mitteilungen von einer wortlosen, doch deswegen vielleicht sogar beredteren Art aufnahm, waren sie Helm unbehaglich. Daher schlug er vor, ihr Zimmer in Augenschein zu nehmen.
Dieses befand sich im 11. und vorletzten Stock und war in der Tat, wie im Online-Exposé versprochen, »großzügig geschnitten«, es besaß sogar ein Fenster zum Meer hin, das sich über die gesamte Länge des Raumes hinzog. Schweigend standen sie davor und schauten hinüber auf den diesigen Horizont unter dem hervor Wellenreihen gegen einen sich weithin erstreckenden Strand schlugen, dessen Sand von einem dunklen, feucht glänzenden Braun war. Isa fragte sich, warum sich niemand am Strand aufhielt. Nachsaison – bemerkte Helm schulterzuckend und fügte nach einer Pause hinzu, dass es möglicherweise auch »an der Krise« liegen könnte.
Dann öffneten sie ihre Koffer, um sich für eine Woche im Zimmer einzurichten, wobei sie indiskrete Blicke auf den Kofferinhalt des anderen vermieden.
Später am Abend unternahmen sie einen Spaziergang am Meer. Es war nicht einfach gewesen, durch die wie geschlossen erscheinende Mauerfront der Meerseite des Hotels zu gelangen. Endlich fanden sie im Kellergeschoss eine kleine Pforte, die, ihnen schien, eher für das Hotelpersonal bestimmt war, denn jenseits von ihr gelangten sie auf einen Hof, der auf drei Seiten von Betonmauern begrenzt war und auf dem sich etwa ein Dutzend überfüllte Müllcontainer befanden. Auf einer Seite führte eine schmale geländerlose Treppe nach oben. Sie gingen sodann über spärlich bewachsenen Boden in Richtung Meer. Die Felsen, an denen sie vorüber gingen, besaßen teilweise tierhafte, mitunter ins Groteske spielende Formen, die sie zu allerlei Assoziationen anregten; manchmal bildeten sie auch Gruppen, die sich zu unterschiedlichen Höhen erhoben. Es gab welche, die merkwürdig übereinander geschichtet waren und wie riesige steinerne Geschirrtürme anmuteten. Dazwischen verstreut lagen leere Plastiktüten, Flaschen und Verpackungen von Gebrauchs- und Konsumgütern. Viele davon hatten einmal Produkte enthalten, die ihnen geläufig waren. Als nahezu bizarr empfanden sie den Anblick eines hohen, geöffneten Kühlschrankes, dessen äussere Roststellen die Anmutung von Kontinenten hatten und der schief neben einer gegenläufig schrägen Gesteinsschichtung, die an übereinander getürmte Dessertschalen erinnerte, im Sand stak. Gemächlichen Schrittes wanderten sie zwischen all dem hindurch, kletterten zum Spaß auch über die ein oder andere Erhebung und richteten ihre Blicke immer wieder auf den fahlblauen oder grauen Horizont über der See und deren gischtsprühende Brandung, der sie sich näherten. Wandten sie sich einmal um, so wurde ihr Blickfeld fast ausschließlich von der Fassade des Hotels eingenommen, das überdies so hoch war, dass man über dem Gebäude nur noch ein schmales Band des wolkenlosen, doch trüben Himmels sehen konnte. Nach einem ihrer kurzen und wie schaudernden Blicke auf diese Wand machte Helm seine Begleiterin auf einen befremdlichen Umstand aufmerksam: nur das untere Stockwerk war beleuchtet, hinter keinem der vielen Fenster in den Stockwerken darüber war Licht zu sehen. In der Folge sprachen sie nur wenig. Als Isa bedauerte, nicht ihr Cello mitgebracht zu haben, da es Helm dann hätte inspizieren und vielleicht einige Verbesserungen daran hätte vornehmen können, das der so Angesprochene mit Befremden oder zumindest mit einem kalten Desinteresse auf, woraufhin sie darauf verzichtete, ihm die Mängel ihres Instrumentes im Einzelnen zu schildern.
Der Sand war in seiner gesamten Breite dunkel vor Nässe, stellenweise hatten sich sogar kleine Pfützen gebildet. Es schien, als würde er von unterirdischen Quellen durchfeuchtet werden. Gerade als Helm sich darüber wundern wollte, dass sie bisher noch kein Lebewesen zu Gesicht bekommen hatten, tauchten hinter einer niedrigen Düne einige Möwen auf, die reglos im Sand kauerten. Sie ließen die beiden Menschen nahe an sich heran kommen, erhoben sich dann und stakten einige Meter weiter, sichtbar ungehalten über die Störung, doch ohne einen Laut von sich zu geben. Ein leichter Wind wirkte beständig an den Spaziergängern, in deren Gemüt bald ein Gefühl Raum griff, das sie letztlich dazu veranlasste, umzukehren und beschleunigten Schrittes zu der kleinen Pforte zurück zu gehen.
Zum Abendessen wurde ihnen von einem weissbefrackten Kellner ein Tisch zugewiesen, der unmittelbar an der langen Fensterfront zur See hin stand. Draussen dunkelte es bereits, wie sie durch die bis fast auf den Boden reichenden weissen Gardinen, die sich über eine gesamte Längsseite des hell erleuchteten Speisesaals hinzogen, erkennen konnten. Es war still in dem großen Raum, doch mit einer gewissen Erleichterung beobachteten sie, wie nach und nach noch andere Gäste eintrafen, um hier das Abendessen einzunehmen. Ihre Zahl war aber so gering, dass sich ihre kleinen Gruppen in der Weite des Raumes verloren. Die Speisen waren ausnahmslos von internationaler Art und Zubereitung, was die beiden begrüßten, ohne so recht zu begreifen, warum sie das taten. Nur der weisse Spätburgunder war von einheimischer Herkunft …
An diesem Punkt seines Berichtes angelangt, machte Helm Anstalten, mit der Beschreibung des Frühstücksbuffets am nächsten Morgen zu beginnen, als ihm ein irritierter Blick Winklers Einhalt gebot. Jener stellte dem Erzählenden auf diese Weise stumm die Frage, wie ihm, Winkler, denn die Erzählung dieses Urlaubs gelingen sollte, wenn Helm bereits zu Beginn seiner Schilderungen derart großzügig Elementarstes und Entscheidendstes ausliess. Es folgte nun eine Pause, nur unterbrochen von einem Seufzer Helms, der auf eine sich vergrößernde Unlust, die Erzählung fortzuführen, hinzudeuten schien. Winkler aber (nachdem dieser sich kurz und ergebnislos die Frage gestellt hatte, warum Männer auch im 21. Jahrhundert noch nicht fähig waren, sich einigermaßen unbefangen untereinander über sie betreffende geschlechtlichen Angelegenheiten zu verständigen), begann schliesslich damit, seine Blicke im Gastraum schweifen zu lassen. Dabei kam in ihm die Frage auf, was er hier, an diesem Ort und zu dieser Stunde, eigentlich tat (ausser einen alten Freund, zu dem er während der zurückliegenden Jahre kaum Beziehungen unterhalten hatte, zu Indiskretionen zu nötigen). Da war ihm mit einem Mal, als ob auch allen anderen Gästen des Lokals diese Frage förmlich auf die Stirn geschrieben stünde: Was suchte man bloß hier? Was immer es auch war, es war klar, dass man es hier wohl kaum finden könnte. Alle Anwesenden dieses gut besuchten Ortes schienen sich vielmehr von hier fort zu wünschen, nicht zuletzt das Personal – junge, gutaussehende Leute, die sich gerade als Protagonisten in die Filmstudios, die angesagten Kunstgalerien, auf die Theater- und Konzertbühnen dieser Stadt sehnten, doch stattdessen hier, in dieser Desillusionierungsrestauration, in der sogar die Wände mit Enttäuschung imprägniert zu sein schienen, ihrer laufenden Kosten wegen Touristen bedienen mussten, die von einschlägigen (und schamlos veralteten) Reiseführern hierher gelockt worden waren.
Winkler war bereits gänzlich abgeirrt in Überlegungen dieser Art, hielt sein Leben schon für ein Phantomgespinst, ja hielt sich selbst für eines jener Phantome, die immerzu nur etwas tun, um etwas zu tun, aber im Eigentlichen nicht wissen, was sie da tun und vor allem: wozu sie es tun. Das würde sich bei dem geplanten Büchlein wohl auch nicht anders verhalten. Andererseits hingegen versinnbildlichte möglicherweise aber genau dies das dominierende Lebensmodell des zweiten Jahrzehnts dieses zweiten Jahrtausends westlicher Zeitrechnung – allein schon ein kurzer Rundblick durch diese Desillusionierungsrestauration (ihm gefiel diese Wortschöpfung, wenngleich er sich nicht sicher war, ob wirklich er sie erschaffen hatte)) könnte ihm als Bestätigung für diese Hypothese herhalten, und vielleicht würde also genau dies, dieses Wissen und die Haltung, die sich daraus hoffentlich ergeben würde, der Publikation immerhin eine gewisse Relevanz als Zeitdokument verleihen …
Da drang endlich wieder Helms Stimme durch den Lärm. Ja, sagte der mit fester, fast trotziger Stimme: In jener ersten Nacht hätten Isaura von Ramsperg und er miteinander geschlafen, natürlich hätten sie das. Und auf die Frage, was er mit »natürlich« meine:
Beide hätten nicht nur das Gefühl gehabt, dass dies eine logische, fast zwangsläufig folgende Konsequenz der Umstände wäre, sondern als müssten sie damit zudem auch noch das artifizielle, fremdartige, versehentlicheder gesamten Situation komplettieren, es durch diesen Akt wie in einem Brennglas konzentrieren. Jene Situation sei ohnehin erst durch eine Kette von Affekten oder gar entstanden und auch das, was in jener Nacht geschah, hatten sie dann hingenommen wie finalen Automatismus, der jedoch in dieser Kette aus willkürlichen und launischen Begebenheiten, zu deren Spielfiguren sie geworden waren, eine unabweisbare Logik besessen habe. Dessen ungeachtet hätten sie gleich zu Beginn den Eindruck gehabt, dass es sich dabei im Grunde zweifellos um ein Versehenhandeln müsse. Helm fühlte sich obendrein von seinen Erinnerungen getäuscht, obwohl er um die Albernheit dieser Empfindung wusste, denn Erinnerungen seien ja schließlich immer Fälschungen. Das Ganze habe ungefähr die Künstlichkeit einer so kapriziösen wie nostalgischen Re-Inszenierung besessen, in deren Verlauf vor seinem inneren Auge immer mehr Bilder aus der Vergangenheit auftauchten, die ihn und Isaura von Ramsperg in intimen Situationen zeigten, ganz plastisch habe er sie vor sich gesehen; allerdings habe er diese Bilder nicht im Entferntesten mit dem, was sich gerade in jenem nur von einer Nachttischlampe beleuchteten Hotelzimmer zutrug, zur Deckung bringen können. Es sei ihm zumute gewesen, grübelte Helm und sprach dabei wie zu sich selbst, als wäre nicht nur seine Gegenwart, sondern auch seine Vergangenheit von einer vollständigen Willkürlichkeit und Beliebigkeit durchdrungen und schon deshalb wäre die Herstellung jeder Art von Kongruenz zwischen den beiden zum Scheitern verurteilt. Eine transparente, jedoch undurchdringliche Haut hätte sich da gespannt, die Vergangenheit und Gegenwart säuberlich voneinander trennte. Dies hätte ein ihm bisher fremdes, irgendwie taubes Gefühl von Ohnmacht verursacht, das er gerne besser definiert hätte, doch so sehr er auch darüber nachdachte, konnte er es sich doch nicht näher erklären. Im Übrigen hätte es sich bei diesem Geschlechtsakt keineswegs um ein offensichtliches Malheur oder gar Desaster gehandelt, auch die »physiologischen Abläufe und Funktionen« hätten keinen Anlass zu einer wie auch immer gearteten Beschwerde oder Klage gegeben, und so fuhren sie wie in einer stummen Übereinkunft damit fort – wohl in Rücksichtnahme auf die Gefühle des Anderen. Möglicherweise wollten sie einfach die lange Geschichte ihrer wechselseitigen Verletzungen nicht fortschreiben. Sie hätten »die Sache« auch zu einem »annehmbaren Abschluss« gebracht (Helm sprach diese Worte in der Tat so aus, als würde er damit auf eine akademische Fachkonferenz oder eine Geschäftsreise Bezug nehmen). Später lagen sie schweigend nebeneinander, bis er endlich vorschlug, dass es vielleicht zu früh dafürgewesen wäre und sie mehr Zeitgebraucht hätten. Isa widersprach ihm, meinte, es sei vielmehr der genau richtige Zeitpunkt dafürgewesen. Sei es, dass sie die Traurigkeit, die von ihm ausging und zu ihr herüberzog, deutlich spürte, sei es auch nur, dass sie Angst hatte, er könnte nun gleich damit beginnen, Dinge zu sagen, die so ähnlich bereits ihr früherer Ehemann zu diesen Anlässen zu sagen pflegte, – jedenfalls entschloss sich Isa an dieser Stelle zwecks einer ihr wünschenswert erscheinenden Deeskalation der Schwermut dazu, eine taktische Banalität zu formulieren. Sie sagte also, sie sollten ihrer Meinung nach dem gerade Geschehenen nicht allzuviel Bedeutung beimessen. »So wird es sich also nicht wiederholen?« fragte Helm daraufhin, und kam damit (ohne es auch nur im geringsten zu ahnen) dem weitläufigen Gebiet der von ihr gefürchteten Fragen schon recht nahe. »Wir werden sehen«, antwortete Isaura von Ramsperg, und das klang für Helm mehr als unbestimmt.

II.
Das Frühstücksbüfett war wie das Abendessen ganz auf einen internationalen Geschmack abgestimmt und damit ohne jede Besonderheit. Helm und Isa nahmen dies bereits wie eine Selbstverständlichkeit zur Kenntnis. Die vorangegangene Nacht schien ihr Verhältnis zueinander, das man zu jenem Zeitpunkt als eines von intimer Fremdheit hätte bezeichnen können, merkwürdigerweise nicht verändert zu haben. Was Isaura von Ramsperg anging, so hätte man gar glauben können, sie habe die nächtlichen Vorkommnisse schon vergessen, und Helm, der in der Nacht noch davon überzeugt gewesen war, ihr Vorschlag, ihnen keine allzu große Bedeutung beizumessen, sei von rein strategischer Natur, war nun geneigt, ihr das im Nachhinein tatsächlich zu glauben, – so sehr verunsicherte ihn der Plauderton, den sie anschlug. Tatsächlich war sie an jenem Morgen auch wirklich bereits um Vieles weniger befangen als am Tage ihrer Ankunft. Doch wäre es ein vorschnelles Urteil gewesen, dies auf eine nunmehrige größere Nähe zu ihrem Begleiter zurückzuführen. Es schien sich dabei vielmehr um eine Unbefangenheit zu handeln, die sich lediglich mit der Unwirklichkeit der Umstände abgefunden hatte, die ihren Frieden mit einer umfassenden Befremdung gemacht hatte. Demgemäß knüpfte sie eine zwanglose, wenn auch für Helms Geschmack ein wenig zu unverbindliche Unterhaltung an: über die Reize von Helms P., über die Besonderheit ihrer Wahlheimat K. und deren Bewohner; sie erkundigte sich nach gemeinsamen Bekannten, von denen sie seit Längerem keine Nachrichten mehr erhalten hatte, und gab schließlich eine zwar unerbetene, doch dafür um so genauere Auskunft über die verwickelten Beziehungsgeschichten eines ebenfalls mit Helm in kollegialem Kontakt stehenden Bogenbauers, der in der Nähe von K. wohnte. Damit lenkte sie das Gespräch auf Musik und äusserte sich kritisch über die von ihr beobachtete Entwicklung in der klassischen Musik, die ihrer Meinung nach dahin ging, dass die Solisten sich immer stärker und ausschliesslicher der Virtuosität verschrieben, einzig zu dem Zweck, um sich mittels eines noch filigraneren, schnelleren, kurz: verblüffenderen Spiels von ihren Konkurrenten zu distinguieren. Der Ausdruck aber, die Seele des Spiels also, würde über diesen ganzen Effekten auf der Strecke bleiben. Helm widersprach dem nicht, teilte ihr Bedauern darüber indessen ebenso wenig, zuckte vielmehr die Schultern und vertrat den pragmatischen Standpunkt, dass diese Entwicklung für ihn als Instrumentenbauer im Grunde eine positive sei, weil er dadurch mit neuen Herausforderungen konfrontiert werde, die ein ansonsten mögliches, ja wahrscheinliches Aufkommen von Routine oder gar Langeweile verhindern würden. Im Übrigen wäre nach seinem Dafürhalten ein augenfälliges Charakteristikum der Gegenwart das zuverlässige und in aller Regel zeitlich nur wenig verzögerte Aufkommen einer dezidierten Gegenbewegung zu jeder beliebigen modischen Strömung. Diese Moden aber seien weder positiv noch negativ zu bewerten – es wären eben lediglich Manifestationen des Zeitgeschmacks. Letztendlich sei er jedenfalls recht froh darüber, dass seine Kunden von ihm nicht mehr ausschließlich die traditionellen, schweren Limousinen geliefert haben wollten, sondern auch mal leichte, wendige Sportwagen. Mag ja sein, von seiner Warte aus … gestand Isa zu, um sich dann etwas gouvernantenhaft zu empören: Doch zu welchem Gekreische und Gezirpe das nicht selten führen würde! Ihr Gehör könne diesen Exaltationen und Atemlosigkeiten oft gar nicht folgen, sie würde davon ganz zappelig werden … Helm fürchtete bereits, sie werde nun wieder, wie damals, damit beginnen, über das Spiel von Jaqueline du Pré zu referieren, die während ihrer gemeinsamen Jahre ihre Lichtgestalt gewesen war. Er beeilte sich deshalb mit der – eigentlich etwas despektierlichen – Bemerkung, diese Reaktion möge für sie und Musiker ihrer Generation typisch sein, nicht jedoch für das zeitgenössische Publikum, für das ein technisch perfektioniertes Spiel schlichtweg eine Selbstverständlichkeit darstelle, da man in einer Epoche lebe, die wesentlich von den Wechselwirkungen von Technologie und Geschwindigkeit geprägt sei. Da merkte Isa in einer aufgesetzten Weise scheinbar lapidar an: Schön, wenn es sich so verhalten würde, könnte man gleich einen Computer in entsprechender Weise programmieren, daraufhin ein »Hochleistungslautsprechersystem« daran anschliessen und einfach dieses Equipment auf die Bühne stellen. Das wäre dann auch viel billiger, und überdies würde man damit gleich dem dritten Epochenpopanz, nämlich der Kosteneffizienz, huldigen. »Wird passieren, nein, passiert bereits schon«, gab sich Helm überzeugt. »Und die Seele, der Geist …?« begehrte Isa zu wissen. »… werden die des Programmierers sein«, ergänzte Helm trocken. Da erkannte Isaura von Ramsperg Christoph Helm durch all seine gegenwärtige Andersartigkeit hindurch zum ersten Mal wirklich wieder.
Später fuhren sie in dem verspiegelten Aufzug hinauf auf ihr Stockwerk, gingen durch den langen, schmalen Korridor, der fast genauso dicht wie unten die Hotellobby mit – allerdings kleineren – Spiegeln und Leuchtern behängt war, zu ihrem Zimmer. Man hätte sie für ein gut situiertes, wohlorganisiertes deutsches Ehepaar mittleren Alters halten können, allerdings befand sich im ganzen Stockwerk niemand, der diese Beobachtung hätte machen können. Einzig das stete Geräusch des Windes war hörbar, das gedämpft durch die Fenster ins Innere drang, an- und abschwellend wie Meeresrauschen. Helm hatte in diesem Augenblick zum ersten Mal den Eindruck, dass sie sich hier möglicherweise in einem System, in einer Maschine bewegten, die zwar sichtlich noch ihre Grundfunktionen erfüllte, dies jedoch in einer seltsam verlangsamten, beinahe friedlichenWeise tat. Sie erschien ihm in diesem Moment bis zu einem Grad entschleunigt, von dem aus es nicht mehr allzu weit bis zu einer umfassenden Aufhebung und Negierung des Zeitmaßes schlechthin sein mochte und der sich somit einem Zustand annäherte, den man zumindest als Stillstand, oder – wenn man dem Metaphysischen zuneigte – sogar als Ewigkeit ätte beschreiben können.
Auf ihrem Zimmer packten sie einige Gegenstände in ihre Tourenrucksäcke, fuhren dann in das Untergeschoss, fanden dort rasch zu der Pforte vom Vortag und wandten dann ihre Schritte dem Strand zu. Dieser war auch heute wieder durchfeuchtet, obwohl es in der Nacht nicht geregnet hatte. Witterung unterschied sich ebenfalls nicht von der gestrigen: eine stetige, nass-kalte Brise wehte vom Meer her, dessen Wasser sich heute allenfalls in einem etwas helleren Grauton vom Himmel absetzten. Unmittelbar um die Horizontlinie bildeten die beiden Elemente ein undeutliches Gemisch, aus dem heraus in zuverlässiger Beständigkeit Wellenfronten herankamen, die einige Meter vor dem Strand in einem letzten Aufbranden unterschiedlicher Stärke zerschellten. Das taten sie an einigen Stellen der Küste heftiger als an anderen, woraus die beiden Urlauber auf das Vorhandensein von Klippen unter der Wasserlinie schlossen. Der Wind trugen ihnen einen etwas scharfen Geruch zu. »Fischgeruch«, befand Isa. »Immerhin«, sagte Helm daraufhin und sie verstand, was er damit meinte. Wieder waren sie die einzigen Urlauber, die einzigen Menschenseelen überhaupt, die sich hier, unter diesem graphitfarbenen Himmel, aufhielten. Wie um diesem Umstand zu trotzen, breitete Isa ein weißes Badetuch aus, schlüpfte umständlich aus ihren Kleidern und in einen dunkelblauen Badeanzug und legte sich auf das Tuch. Helm merkte an, der Vorzug von solch einem Wetter wäre, dass man keine Sonnencreme auftragen müsse. Er selbst begnügte sich allerdings damit, einen Pullover aus seinem Rucksack hervorzuziehen und sich auf diesen zu setzen. So liessen sie für eine Weile den Wind über sich streifen, hörten dem Brechen der Wellen zu. Als Isa einmal den Kopf zu ihrem Begleiter wandte, sah sie sie sein Gesicht teilweise verdeckt von einem silberfarbenen, an den Ecken gerundeten Gegenstand, den sie sofort als ein Smartphone identifizierte. »Und?« fragte sie. »Nichts wirklich Neues«, antwortete Helm. So zog sie denn jenes abgeschabte braune Lederfutteral aus ihrem Rucksack, das eine mattgrau-metallene Fotokamera aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts enthielt. Bevor sie am gestrigen Tage zu ihrem ersten Ausflug ans Meer aufgebrochen waren, hatte Isa sich tatsächlich dieses Futteral an seinem ledernen, Trageriemen um den Hals gehängt, woraufhin Helm sie wortlos, doch offenen Mundes und unter Blicken anstarrte, in denen sich Belustigung, Verblüffung, Resignation und auch so etwas wie Beschämung durchmischten. Jetzt entnahm sie also dieses mechanische Ungetüm seiner Umhüllung und ging ohne ein Wort davon. Als sie wieder vor ihm auftauchte, schaute er nur kurz vom Display seines Gerätes auf. Er hätte unmöglich sagen können, wie lange sie fort gewesen war; vielleicht eine Stunde, vielleicht aber auch nur zehn Minuten. Als er sie beiläufig fragte, ob die Bilder, die sie aufgenommen hatte, »etwas geworden« wären, bemühte er sich, ein Anteil nehmendes Interesse in seine Stimme zu legen und seine Spottlust, die ja der eigentliche Antrieb der Frage gewesen war, nicht allzu deutlich durchklingen zu lassen. Das könnte sie ihm erst in einigen Wochen sagen, antwortete Isa scheinbar arglos. Damit, sagte er dann und hielt sein Smartphone etwas höher, könne man nicht nur sofort die Qualität der Aufnahmen genauestens überprüfen, sondern sie schon im nächsten Moment in alle Welt verschicken oder aber via Internet die Bilder gleich aller Welt zugänglich machen. Nun, soviel wisse sie auch – das sei aber nichts für sie, entgegnete sie spitz. Sie könne ein Bild nur beurteilen, nachdem genügend Zeit seit seiner Aufnahme vergangen wäre; soviel Zeit, wie es bräuchte, damit sich eine mehr oder minder ferne Erinnerung an diesen Augenblick in ihrem Gedächtnis habe herausbilden können, die sie dann mit dem fotografischen Bild abgleichen könne. Doch wäre das nicht der einzige Parameter, den sie gelten liesse: manchmal stiesse sie auf Bilder, die unwillkürlich eine gewisse Erinnerung in ihr hervorriefen, ja es gäbe sogar Aufnahmen, die Erinnerungen in ihrem eigenen Gedächtnis geradezu erst kreierten, und sie würde dann also durch das Auge anderer Personen denken und empfinden. Das wäre indes sehr selten und sie vermute, bei diesen müsste es sich zwangsläufig um die gelungensten Bilder handeln. Nun, sagte Helm nach einer Pause, auch das mochten Kriterien sein, die er respektiere, doch glaube er, dass diese wenig mit dem tatsächlich relevanten Gebrauch der Bilder als Kommunikationsmedium in ihrem gegenwärtigen Zeitalter zu tun haben. Darüber maße sie sich kein Urteil an, versetzte Isa darauf, doch sei sie überzeugt, dass zu allen Zeiten schon und ganz unabhängig davon, auf welchem Stand die Technik sich gerade befunden habe, es im Grunde überall und immer nur um die gleichen Dinge gegangen wäre. Damit brach das Gespräch unvermittelt ab. Möglicherweise trug Helm Bedenken, dass seine Reisegefährtin ihn mit solchen Reden auf das Terrain des Ungefähren locken wollte, dem er als Anhänger des Konkreten, Überprüfbaren misstraute.
Schon bald darauf begann Isa auf ihrem von Luft- und Bodenfeuchtigkeit bereits klammen Badetuch zu frösteln, weshalb sie zum Aufbruch drängte. Mittlerweile war ihr auch klar geworden, wie unangemessen, ja kindisch dieser Strandaufenthalt war. Helm bat jedoch um einige Minuten Aufschub, da er noch eine eilige Rechnung erstellen und versenden müsse. Isa hatte sich längst schon angekleidet und das Tuch in ihrem Rucksack verstaut, ging bereits ungeduldig auf und ab, während Helm, äusserlich ganz ruhig auf seinem Pullover sitzend, noch den Mehrwertsteueranteil des Rechnungsbetrages kalkulierte. Dabei kamen ihm einige dem jetzigen ähnliche Bildern aus ihrer gemeinsamen Vergangenheit in den Sinn, die er in seinem Geiste säuberlich aneinanderreihte wie die Thumbnails einer digitalen Datei; – kalt lächelte er nun darüber, dass sie nicht einmal zwei Tage gebraucht hatten, bis sie wieder damit begannen, sich gegenseitig auf die Nerven zu gehen.
Als er endlich fertig war, schlenderten sie, da noch einige Zeit bis zum Mittagessen zuzubringen war, in die Richtung des nähergelegenen der beiden Felsmassive von denen der Strand auf natürliche Weise begrenzt war. Als sie dessen erste Schichtungen erreicht hatten, stiegen sie das felsige Gelände ein wenig empor. Es gab dort stellenweise einen niedrigen, strauchartigen Bewuchs, der für Isa eine wirkliche Freude zu sein schien. Aus seinem grünen Nadelgezweig flogen immer wieder Insekten auf. Sie reichte Helm eine von den beinahe perlmuttfarbenen, kugelförmigen Früchten mit der Aufforderung, davon zu kosten. Es helfe gegen Vergesslichkeit und andere Denkschwächen, behauptete sie. Helm kaute skeptisch auf der bittersüssen Frucht herum und spuckte sie aus, gerade als Isa einen bräunlichen Schmetterling genauer betrachtete, der mit im Wind zitterndem Flügelpaar auf einem Zweig eines Beerenstrauchs geruht hatte und sich im selben Moment, als Isa sich zu ihm hinabbeugte, über sie hinweg emporhob.
Am Abend sahen sie sich in einem eigens zu diesem Zweck hergerichteten Raum eine Filmvorführung an. Es handelte sich bei dem Film um eine nicht mehr ganz neue Hollywoodproduktion, und die weibliche sowie die männliche Hauptrolle wurden von zwei Stars verkörpert, deren Namen die beiden zwar schon des öfteren vernommen hatten, deren Gesichter ihnen jedoch völlig unbekannt waren, denn beide gingen seit Jahren nicht mehr ins Kino. Die beiden Schauspieler verkörperten einen ehemaligen Börsenmakler und eine ehemalige Asset-Managerin, die einander zuzeiten, als sie noch aufstrebende Jungtalente gewesen waren und bei derselben Investmentbank gearbeitet hatten, heftig gemobbt hatten. Doch das sah man lediglich in kurzen, bis zur Verschwommenheit unscharf gefilmten Rückblenden. Nun, einige Jahre später, begegneten sie sich in einem von einer Flutwelle und noch einigen anderen Natur- oder besser Zivilisationskatastrophen völlig verwüsteten New York wieder. Sofort beginnen wieder die alten Animositäten und Auseinandersetzungen, doch nunmehr müssen sie sich wohl oder übel zusammenraufen, alleine schon, um sich einer marodierenden Bande von Entmenschten zu erwehren, die ihnen hartnäckig nach dem Leben trachtet. Selbst ein aufmerksamer Zuschauer vermag das zuerst nicht zu verstehen, doch dann stellt sich im Verlaufe eines dramatischen Zweikampfes zwischen dem früheren Börsenmakler und dem Bösewicht des Filmes heraus, dass Letzterer, der Hauptmann der Entmenschten, in seinem früheren Job als Fahrradkurier jenes Bankhauses wiederholt von dem Helden gedemütigt worden war und diesem deshalb ewige Rache geschworen hatte. Für dieses Mal geht das Duell unentschieden aus, doch in seiner Folge werden der ehemalige Börsenmakler und die ehemalige Asset-Managerin voneinander getrennt. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die beiden allerdings natürlich bereits ineinander verliebt und durch dieses reine Gefühl quasi beiläufig eine endgültige und vollständige Läuterung von ihrem ganz und gar von vorsintflutlichem Raubtier-Kapitalismus geprägten Vorleben erfahren. Und natürlich war ihnen unmittelbar vor dem Kampf auch schon eine erste romantische und leidenschaftliche Nacht in den Ruinen eines ehemaligen Sushi-Restaurants vergönnt gewesen. Nun aber müssen sie fortan also wieder auf eigene Faust durch die Trümmerlandschaften ihrer zerstörten Stadt irren, immer auf der Suche nach Nahrung und dem geliebten Menschen, immer verfolgt und bedroht von den Entmenschten. Endlich – nach allen Arten von Irrungen und mit knapper Not überstandenen Gefahren – finden sie sich in der Speisekammer eines früheren YMCA-Hostels wieder, und das junge, und ja, natürlich irgendwie auch glückliche Paar bezieht kurz darauf gemeinsam die völlig verwüstete Chefetage ihrer ehemaligen Bank. Sie können sich dort indessen nur notdürftig mithilfe von Mobiliar und Computerschrott verbarrikadieren, bevor sie sich in einer finalen Entscheidungsschlacht der Bande des ehemaligen Fahrradkuriers stellen müssen. Es sieht eine ganze Zeit lang gar nicht gut für das Heldenpaar aus, doch dann gelingt es im Verlaufe eines äusserst dramatischen Zweikampfes auf dem Dach des Hochhauses dem ehemaligen Börsenmakler, den ehemaligen Fahrradkurier zu bezwingen. Währenddessen hatte seine Bande in der darunter gelegenen, früheren Chefetage die ehemalige Asset-Managerin fast schon überwunden, obwohl diese sich mit einem Maschinengewehr im Inneren des ehemaligen Konferenztisches verschanzt hatte und sich heldenhaft verteidigte. Da sehen die Entmenschten ihren Anführer schrecklich grimassierend am Fenster vorbei in die Tiefe stürzen, und nachdem sie während einer plötzlich eintretenden Stille seinem markerschütternden Todesschrei hinterher gelauscht hatten, hebt unter ihnen ein Johlen und Klagen in Primatenart an. Völlig kopflos geworden, flüchten sie aus dem Gebäude. Nun könnte alles gut gewesen sein, doch leider wurde bei diesem letzten Angriff der Entmenschten der Held von einer Art archaischen Lanze aus rostfreiem Stahl, mit der der ehemalige Fahrradkurier zu kämpfen pflegte, schwer verletzt und der Zuschauer muss deshalb noch einige Minuten um dessen Leben bangen und mit Anteilnahme verfolgen, wie aufopfernd die Heldin ihren Geliebten mit einfachsten Hilfsmitteln pflegt, während im Hintergrund immer wieder vereinzelte Schüsse und Detonationen zu hören sind und des Nachts die in der Ferne lodernde Brände einen schwachen Widerschein auf das schweissgebadete Antlitz des Rekonvaleszenten werfen. Eines Tages – es ist zu Anfang des Frühlings, was man an den Blüten einiger kleiner, in Kübel gepflanzten Obstbäumchen auf dem Dach des Turmes erkennt – ist sich die Heldin endlich dessen gewiss, dass der Mann, den sie liebt, leben wird; am Abend jenes Tages eröffnet sie ihm, in seinen Armen liegend, dass sie ein Kind von ihm erwartet. Dann folgt noch ein langer Kameraschwenk durch das zerschossene Fenster und auf die Skyline von Manhattan, oder besser: auf das, was von ihr übrig geblieben ist. Der Zuschauer sieht also als Schlussbild einige skelettartige Türme mit verkohlten Fassaden und weitgehend entkerntem Inneren. Dort, wo einmal grosszügige Fensterfronten gewesen waren, gibt es nur noch dichte Netze von schwarzen Löchern, die aussehen wie Höhleneingänge. In der Tat steigt aus dem ein oder anderen dieser gähnenden Schlünde eine dünne Rauchsäule in den glutroten Abendhimmel, wobei offen bleibt, ob die Ursache davon Schwelbrände sind oder Feuer, an denen sich andere Überlebende, seien es nun Menschen oder Entmenschte, Nahrung garen.
Isa erinnerte sich, vor einiger Zeit in einer Zeitschrift gelesen zu haben, dass der Film an den Kinokassen gefloppt war, was der Autor des Artikels mit einer unverhohlenen Genugtuung, die ihr damals noch unverständlich war, darauf zurückführte, dass zwei Stars eben doch nicht einen mittelmäßigen und zu oft schon bemühten Plot retten könnten, auch wenn diese zugestandenermaßen in dem vorliegenden Fall zu ihrer Höchstform aufgelaufen wären.
Auch an diesem Abend hatten sich nur wenige Zuschauer im Vorführraum befunden.

III.
Am Morgen des dritten Tages blickte Isa von Ramsperg aus dem Fenster ihres Zimmers im 11. Stock des Futura Beach Grand Hotel*** und konstatierte erfreut ein immerhin changierendes Licht. Zwar sah der Himmel immer noch wie ausgewaschen aus, doch gelang es den Sonnenstrahlen ein ums andere Mal, durch die bleiche, doch nicht mehr gänzlich unüberwindbare Wolkendecke zu stossen. Bei dieser Gelegenheit bemerkte sie zu ihrer Überraschung, dass das Meer, von hier oben aus besehen, durchaus nicht diese graue, den Blicken undurchdringliche Masse war, als das es sich in der horizontalen Strandperspektive darstellte. Unverzüglich holte sie ihr Fernglas hervor – für Helm ein weiteres der von ihr mitgeführten und ihm merkwürdig aus der Zeit geschlagen erscheinenden Utensilien, vermeinte er doch, dass nur Jäger und ähnlich archaische Gestalten ein solches noch benutzen würden. Mit seiner Hilfe vermochte sie im Uferbereich ausgezeichnet die Partien mit Unterwasservegetation von denen zu unterscheiden, wo der Meeresboden nur mit Sand bedeckt war. Sie erahnte unterseeische Wiesen von Neptungras. Und in der Tat konnte sie im Bereich der Ausläufer der beiden Felsformationen einige dunkle Flecken ausmachen, bei denen es sich um Riffe handeln musste. All dies teilte sie ihrem Begleiter mit, der – damit beschäftigt, die am Nachmittag und Abend des Vortages eingegangenen Nachrichten seiner E-Mail-Accounts zu sichten – sich allerdings nicht allzu sehr dafür zu interessieren schien. So ging sie hinüber in das Badezimmer, wo sie sich eigentlich nur die Zähne putzen wollte, stattdessen aber lange und ausdauernd in den Spiegel blickte, mit dem wenig erfolgreichen Versuch befasst, ihr Gesicht mit den Augen eines Fremden zu betrachten. Schliesslich seufzte sie, schnitt unter vollständiger Entblößung beider noch überdurchschnittlich gut erhaltenen Zahnreihen eine Grimasse und entnahm dann ihrer Toilettentasche Zahnbürste und Zahnpasta, wobei ein kleiner Gegenstand auf die Kacheln fiel. Erst nachdem sie sich hingekniet hatte und das Ding mit ausgestrecktem Arm unter dem Waschtisch hervor geangelt hatte, erkannte sie in in ihm jenen kleinen grünen Plastikfrosch, den sie seit nunmehr sieben Jahren auf all ihren Reisen in ihrem Neçessaire mitführte. Sie stellte jetzt fest, dass sie die Figur noch genauso scheusslich fand wie an jenem Tage, als ihre Tochter sie ihr zum Geburtstag geschenkt hatte, dabei nicht ohne kindliche Tücke versichernd, es würde sich bei dem Geschenk um einen Glücksbringer und Beschützer handeln. Das Ding sah nicht nur abstossend aus, es fühlte sich auch unangenehm an, bei jeder Berührung dachte man unwillkürlich an die Vielzahl der Giftstoffe, die das Material enthalten musste. Zudem verfügte die Figur auch noch über einen Leuchtmodus. Isa hatte damals nicht allzu viel über die Motive, die ihre Tochter dazu gebracht haben mochten, ihr so etwas zu schenken, nachgedacht, sondern das Geschenk für eine jener rätselhaften bis obskuren Gaben gehalten, mit denen Heranwachsende Erwachsene im Allgemeinen und die eigenen Eltern im Besonderen und mit Vorliebe zu verstören pflegen. Widerwillig musste sie sich nun eingestehen, dass sie begann, diesen Ausbund an Hässlichkeit mit Rührung zu betrachten; sie drückte der Figur sogar mit dem Zeigefinger auf den glatten, grünen Bauch und war beinahe beruhigt, als das Ding daraufhin begann, aus seinen Innereien in gleichmäßigen Intervallen gelbe, blaue und rote Strahlen zu entsenden. Mit einem weiteren Fingerdruck stoppte sie das Leuchten des Frosches und stellte ihn danach betont achtlos auf dem Toilettenschrank ab.
Ihre Abwesenheit hatte Helm für einen raschen Blick durch das Fernglas genutzt. Er musste sich eingestehen, dass es sich um ein optisches Instrument von vorzüglicher Qualität handelte. Er konnte sogar klar unterscheiden, auf welchen dem Strand vorgelagerten Felsen es Entenmuschel- populationen gab. Sodann richtete er das Glas weiter hinaus in die flache, fahle See hinein, wo er den Weg von gemächlich sich gen Land schiebenden Wellenkämmen verfolgte. Unbestimmt hoffte er, noch mehr als das zu sehen, doch hätte er nicht zu sagen vermocht, was das hätte sein können. Als er spürte, dass seine Zimmergenossin hinter ihn getreten war, setzte er das Fernglas ab. »Gutes Stück«, sagte er anerkennend, wenngleich etwas herablassend und ohne sich dabei umzudrehen. »Noch von meinem Vater«, murmelte Isa nur, als ob dieser vormalige Besitzer Erklärung genug für die Güte des Gerätes sei.
Nach dem Frühstück, das sie an ihrem bevorzugten Tisch eingenommen hatten, saßen Isa und Helm schweigend vor ihren leeren Tassen. Als ihnen wieder einmal das widersinnige, schon leicht ins Irrsinnige spielende Leitthema dieser Tage wie eine gasförmige Substanz in der Atmosphäre spürbar zu werden begann und ihre Stimmung zu verdüstern drohte, schien es Helm angezeigt, ein Gespräch über die zukünftige Art ihrer Beziehung anzuknüpfen. Isa liess sich aber nur sehr widerwillig darauf ein, denn sie war überzeugt, dass es ihnen ohnehin nicht möglich wäre, auf diesem Wege zu irgendwelchen Klärungen zu kommen, sondern es im Gegenteil viel wahrscheinlicher sei, wenn dadurch das gemeinsame Konto mit noch einigen Missverständnissen und Verwirrungen mehr belastet werden würde. Lebhaft traten ihr bei dieser Gelegenheit die klärenden Gespräche mit ihrem ehemaligen Ehemann vor Augen, die früher oder später letztendlich fast alle selbst Bestandteile der stetig anwachsenden Klärungsbedarfsmasse geworden waren. Diese ihre Unlust führte zu einer Misstimmung, ja Verbitterung bei ihrem Begleiter, der sich gar dazu hinreissen ließ, den Umstand seiner Kinderlosigkeit und dessen Zustandekommen zu bedauern, was in Isa wiederum den Verdacht aufkommen ließ, in dieser Klage könnte am Ende gar ein versteckter Vorwurf an sie selbst lauern. Dieser wäre fraglos ungerechtfertigt gewesen, weil bis zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar auszumachen war, wer damals eigentlich wen verlassen hatte. Als Helm sich kurz darauf gar anmaßte, mit einer unguten Mischung aus heuchlerischem Mitleid und schlecht verhohlener Genugtuung von ihrer »gescheiterten Ehe« zu sprechen, fiel sie ihm ins Wort und beschied ihm, ihre Ehe sei keineswegs »gescheitert«, sondern hätte vielmehr »geendet« – was, wie er eines Tages vielleicht auch noch einmal verstehen würde, einen unendlichen Unterschied ausmache.
Als sie etwas später am Strand anlangten, war Isa noch stark verstimmt. Helm spürte das deutlich, und möglicherweise, um ihre Besänftigung etwas zu beschleunigen, stieg er nun zum ersten Mal ebenfalls in seine Badehose und legte sich neben sie. Er lag dann dort, hustete gelegentlich, und in dem Maße, in dem er sich beruhigte, wuchs die Beschämung in ihm: Zu jener Zeit, als sie beide noch ein Paar gewesen waren, war sein Ziel gewesen, der beste Cellobauer seiner Zeit zu werden, und ein Kind hätte er für das Letzte gehalten, was er dabei hätte brauchen können.
Immer deutlicher spürte er übrigens, dass die spezifische Fremdheit Isas für ihn die Funktion einer Projektionsfläche hatte, ein Spiegel für sein Leben während der letzten zweieinhalb Jahrzehnte war. Er besah es sich darin ohne Enttäuschung. Ohnehin fand er: ob einer nun eine Familie gründete, ruhelos die Welt bereiste, oder aber einer Vision, einem inneren Auftrag folgte, der ihm nur sehr begrenzt erlaubte, seine Wirkstätte zu verlassen – in der Rückschau würde, was immer es auch war, worauf seine Wahl letztlich gefallen war, ohnehin stets als die falsche Entscheidung empfunden werden. Was blieb einem dann also, als sich für eine Sache zu entscheiden, denn was würde andernfalls von einem Leben bleiben als eine flaue Ansammlung von Unentschiedenheiten?
Unterdessen hörte Isa seinem Husten zu. Sie kannte das nicht von ihm, doch natürlich wusste sie, es war der Staub, der ihn husten ließ, Staub, der über Jahre und Jahrzehnte langsam, doch stetig an seinem Atemorgan gewirkt hatte. Sie erinnerte sich einer alten Faustregel der Bogenbauer: Die besten Hölzer sind für gewöhnlich auch diejenigen, die dem, der mit ihnen arbeitet, am meisten zusetzen. Helm arbeitete zweifelsohne mit den besten Hölzern. Für sie stand ausser Zweifel, dass es nach wie vor nur eine einzige Hauptkonstante in seinem Leben gab: Er wollte, bei allem was er tat, sein Bestes geben. Bereits damals war er unfähig gewesen, zu verstehen (oder gar zu akzeptieren), dass es Leute gab, die das nicht so sahen, weil sie eine andere, etwas kleiner gefasste oder womöglich gar keine Maxime hatten. Wenn er mit Unzulänglichkeiten konfrontiert worden war (und das war nicht gerade selten geschehen), hatte er rasend werden können; er vermochte es nicht zu fassen, dass vernunftbegabte Menschen sich derart durch ihr Leben stümperten und offensichtlich nicht einmal Beschämung oder Trauer darüber empfanden. Dieser Anspruch an sich und andere war nicht immer einfach zu ertragen gewesen, vor allem für sie nicht, die ihm in jener Zeit am Nächsten gestanden hatte. Man könnte auch einfach sagen: Helm war anstrengend gewesen, und er war es nach wie vor. Doch auch deswegen hatte sie vom ersten Tag ihrer Bekanntschaft an seine Nähe gesucht. Sie wollte sehen, wohin ein Mensch gelangen könne, wenn er sich nur von seinen Überzeugungen und einem unverbrüchlichen Vertrauen in seine Möglichkeiten leiten liesse. Zwar hatte sie insgeheim stets befürchtet, ihre Sache sei das nicht, doch wusste sie auch, dass ein Mensch kaum einen größeren Besitz haben könnte als diese spezifische Hingabe.
Was Helm anging, so hatte er spätestens seit dem schon viele Jahre zurückliegenden Tag, an dem er sich zum ersten Mal an das Türgeviert seine Materialschuppens klammerte, um sich nur nicht noch immer mehr zusammenkrümmen zu müssen, dabei voller Schrecken auf die fremden Laute horchend, die da aus ihm herausbrachen, – spätestens da hatte er also in einer recht beiläufigen, doch nicht minder drastischen Weise einiges über den weiteren Verlauf seines Lebens erfahren. Fortan hatte er einen neuen Antrieb, der nicht mehr in dieselbe Kategorie fiel wie ehrgeizige Meisterschülerphantasien nach Anerkennung oder naive Träume von Ruhm. Er wollte nun der Beste werden, um aus der Tretmühle des Produktionszwanges herauszukommen; er wollte jeden Preis verlangen können und auch erhalten. Nur noch zwei oder drei, allenfalls vier Instrumente im Jahr bauen zu müssen, und alle Zeit der Welt dafür haben. Allein er vermochte das nie zu erreichen, im Gegenteil, die Konkurrenz hatte sich seitdem vergrößert, es kamen junge Talente mit unkonventionellen Ideen und Methoden, die nicht zuletzt deshalb flexibler als er waren, weil sie keinerlei dogmatischen Traditionalismen anhingen. Ferner kamen in den letzten Jahren verstärkt semi-industriell gefertigte Instrumente aus China auf den Markt, die erstaunliche Klangeigenschaften besaßen und bereits in die hochpreisigen Marktsegmente vorgedrungen waren. Und dann kam auch noch die Krise.
Er seufzte, doch dann überraschte er Isa mit dem Vorschlag, gemeinsam nach vorne zum Wasser zu gehen.
Dort standen sie dann dicht beieinander, schweigend und fröstelnd. Helm richtete seinen Blick hinunter auf die grau-braunen Schaumkronen um seine blassen Beine. Endlich gingen sie bedächtig einige Schritte weiter, wie Wasservögel, die ihre Beute nicht vertreiben wollen. So kamen sie in den Bereich der Wellenausläufer, die ihnen bis an die Oberschenkel reichten. Die Wellenkämme aber kamen in voller Größe und Macht bis auf einige Meter an sie heran. Sie erschienen ihnen wie wilde, furchtlose Tiere. Nach einer Weile kehrte Isa, ohne ein Wort zu sagen, um. Helm folgte ihr. Nach einer kurzen Beratung packten sie die herumliegenden Gegenstände in ihre Rucksäcke und machten sich auf den Weg zu der entfernter liegenden Felswand zu ihrer Rechten. Unterwegs näherten sie sich einer farblosen Masse im Sand, die sich beim Näherkommen als eine Qualle erwies. Es war nurmehr eine gelatineartige Aufhäufung, die kaum mehr Rückschlüsse auf ihre frühere Form zuliess. Dennoch äusserte Isa die Vermutung, das Tier könnte noch leben, was Helm bestritt. Ausserdem könne es giftig sein, fügte er noch hinzu, das Gift mancher Quallenarten wirke geradezu tödlich. Daraufhin zog Isa ihren Badeanzug aus dem Rucksack, streifte ihn sich über einen ihrer nackten Füße und bugsierte mit diesem dann – das Kleidungsstück dabei in Höhe ihres Oberschenkels so festhaltend, dass sein Stoff straff gespannt war – den glibbrigen Klumpen ins Wasser zurück. Dort trieb er in der Dünung, noch immer unförmig und ohne Eigenbewegung. Helm zuckte mit den Schultern und ging weiter, während Isa den Badeanzug in eine Aussentasche ihres Rucksackes stopfte. Dann stand sie noch ein Weniges vor dem Klumpen, ihn aufmerksam betrachtend, gerade so, als wollte sie ihm noch eine Chance geben.
Als sie den Fuß der Steilküste erreichte, saß Helm auf einem flachen Stein und deutete wortlos mit dem Kopf auf einen kleinen Pfad, der sich zwischen den Felsen nach oben wand. An schwierigen Stellen war er zur Seeseite hin zusätzlich mit Seilen abgesichert, die allerdings bereits etwas altersspröde waren. Nachdem sie einige dutzend Meter aufgestiegen waren, verlor sich der Pfad und die beiden kletterten nun über Felsplatten und zwischen mannsgroßen Gesteinsbrocken weiter. Ein ums andere Mal zögerten sie, welche Richtung sie einschlagen, welche Wegvariante sie wählen sollten. Wiederholt mussten sie wieder etwas nach unten klettern, weil sie sich falsch entschieden hatten. Einmal, als sie gerade um eine hoch über ihnen emporragende Felsnadel bogen, tat sich unvermittelt unter ihnen ein Abgrund auf. Schaudernd sahen sie durch zerklüftete Wände zwanzig, vielleicht auch dreissig Meter in eine schwärzliche, schachtartige Tiefe. Ganz unten, im Halbdunkel einer natürlichen Kathedrale, umzüngelte das Meer das Gestein, und das Geräusch dieses Aufeinandertreffens hallte dumpf bis zu ihnen herauf. Da sie nicht mehr weit unterhalb des Grates der Steilküste sein konnten, entschieden sie sich dafür, weiter nach oben zu gehen, in der Hoffnung, dort einen Weg zu finden, der sie sicher auf der anderen Seite des Massivs nach unten führen würde. Das Branden der Wellen drang nur noch ganz schwach zu ihnen empor. Später standen sie auf halber Höhe eines abschüssigen Geröllfeldes vor einem dunklen Schlund, in den Helm vorsichtig den Kopf streckte. »Komm«, sagte er dann und wand sich durch die niedrige Öffnung ins Innere.
Als sich ihre Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, sahen sie sich in einem geräumigen, fast runden Raum, in dem Isa aufrecht, Helm nur um weniges gebückt zu stehen vermochte. In seiner Mitte war auf dem Boden ein Kreis aus faustgroßen Steinen ausgebreitet, in dem einiges halbverkohltes Geäst lag. Sie setzten sie auf zwei der großen Steine, die vor der Feuerstelle lagen, und während sie durch die Eingang jenseits davon schauten, in dessen ungefährer Mitte die Horizontlinie die beiden Elemente schied, stellten sie Überlegungen darüber an, wem diese Höhle ansonsten Schutz und Unterkunft bieten könnte. Helm wollte anhand des Zustandes des Feuerholzes ableiten können, dass die Höhle vor noch nicht allzu langer Zeit genutzt worden wäre, was Isa nicht ganz einleuchtete. Sie hingegen wunderte sich über das Fehlen jeglicher menschlicher Hinterlassenschaft, sei es Verpackungsmüll oder auch nur ein kleines Stück Papier, eine Zigarettenkippe, ein abgebranntes Streichholz. Da Helm ihre Beobachtung unkommentiert liess, begann sie, die Vorteile, die eine solche Behausung haben könnte, gegen diejenigen ihrer jetzigen Unterkunft im Futura Beach Grand Hotel*** abzuwägen, was Helm lediglich zu einem Stirnrunzeln veranlasste. Daraufhin schwieg auch Isa und so überließen sie sich und ihre Stimmungen der heimelig-unheimlichen Atmosphäre des Ortes. Schließlich begann Isa mit der Erzählung eines »überaus kuriosen Falles«, der sich zu Beginn des Jahrtausends an der Felsküste von M. zugetragen habe. Ein Student aus P. sei dort in die Tiefe eines Abgrunds gestürzt, der möglicherweise ähnlich demjenigen beschaffen war, in den sie gerade eben bei der Felsnadel geschaut hatten. Die Behörden hätten nach ihm suchen lassen, ihn aber nicht gefunden und ihn deshalb für tot erklärt. Tatsächlich hätte der Student aber überlebt, wenn auch erheblich verletzt; er sei dort in der Tiefe von einem seltsamen Individuum zwischen den Steinen hervorgezogen und gesund gepflegt worden. Bei jenem hätte sich um eine Art von Angler-Eremiten gehandelt, der seit Jahr und Tag schon in den Tiefen und Höhen jener Steilküste lebte. Er hauste in einer Höhle, die vielleicht dieser hier ähnlich gewesen sein mochte. Der ehemalige Student aber – es sei ihr leider entfallen, was er studiert habe – gewöhnte sich sehr schnell an das neue Leben, wobei ihm sicherlich der völlige Gedächtnisverlust half, den er bei seinem Sturz davongetragen habe. Gemeinsam fingen die beiden Männer von nun an in den abgründig tiefen Wassern kleiner Felsbuchten Fische von oft erstaunlicher Größe, des Nachts füllten sie an einer nahen Quelle Trinkwasser in auf Parkplätzen zurückgelassene Plastikflaschen ab und nahmen es in ihr Versteck mit; – es fehlte ihnen eigentlich an nichts, in den Mülleimern jener Parkplätze fanden sie sogar regelmäßig Kekse und noch essbares Brot. Der junge Mann lernte schnell die Sprache des Eremiten – ein Gemisch aus den verschiedenen Idiomen, die jener in seinem früheren Leben einmal beherrscht haben mochte und scheinbar frei erfundenen Wortschöpfungen. Der Alte erzählte ihm des Abends am Feuer in seiner kehllautigen, doch eigentümlich melodiösen Sprache manche Geschichte aus seiner Welt und trug sogar selbstgedichtete Lieder vor. Die Jahre vergingen, auch im Aussehen glich der vormals junge Mann nun immer mehr seinem Lehrer. Eines Tages versuchte der Alte eine Angelschnur, die sich in einer jener Felsgrotten unter Wasser verhakt hatte, freizubekommen. Es handelte sich um eine Bagatelle, um eine Bagatelle allerdings, von der der Eremit nicht mehr auftauchte. Der Jüngere kehrte in ihre Höhle zurück und lebte von diesem Zeitpunkt an alleine in den Felsen. Das sei ihm jedoch nicht gut bekommen, denn er verlor nach und nach seine Sprache und begann damit, die gefangenen Fische roh zu verspeisen, möglicherweise, weil ihm die Brennholzsuche alleine zu beschwerlich war. In dem Maße jedoch, in dem er seine Sprache verlor, verlor er auch den Verstand. Ein gutes Jahrzehnt war seit seinem Sturz vergangen, als er eines Tages von einem Trupp Entenmuscheln-Sammlern gefunden wurde, die ihn den Behörden übergaben. Daraufhin wurde das verstörte Individuum in die psychiatrische Klinik von C. verbracht, wo man sein Verhalten studierte und international besetzte Symposien über seinen Fall veranstaltete. Er würde sich heute übrigens immer noch in jener Klinik befinden, die Aufregung um ihn habe sich allerdings längst gelegt. Inzwischen würde er einer beschaulichen Beschäftigung als Gärtner im Park des Spitals nachgehen.

Wo sie diese Geschichte denn gelesen habe? – erkundigte sich Helm misstrauisch, nachdem Isa ihren Bericht beendet hatte. Das wisse sie nicht mehr so genau; irgendwo eben, antwortete sie ausweichend.
Schon bald, nachdem sie die Höhle wieder verlassen und den Grat erreicht hatten, sahen sie unweit vor sich einen breiten Weg, eine Sandpiste, die sich durch die niedrige Vegetation des hier gemächlich ansteigenden Plateaus schlängelte und auf der sie bequem nach unten zur Zubringerstraße des Hotels gelangen würden.
Als sie diese beinahe schon erreicht hatten, hob plötzlich hinter ihnen ein Donnern an, das sie unvermittelt innehalten, sich umdrehen und in den Himmel schauen liess. Das Geräusch wurde rasch lauter, ohne dass das Grau über ihnen Spuren einer Veränderung gezeigt hätte; jetzt war es schon genau über ihnen und Isa verschloss die Ohren mit ihren Handtellern. Eine Sekunde darauf hatte sich das Donnern auch schon wieder entfernt, es verzog sich in das Landesinnere, verklang innerhalb weniger Sekunden und war die ganze Zeit über unsichtbar und körperlos geblieben.
Sie hätte nicht gedacht, dass sie hier Überschallflugzeuge hätten, wunderte sich Isa. Dies sei ein europäisches Land, die hätten hier alles, behauptete Helm.
In dieser Nacht wachte Isaura von Ramsperg auf. Es mochte bereits dem Morgen zugehen. Mit Missbehagen bemerkte sie ihr feuchtes Bettlaken. Sie musste stark transpiriert haben, was sie entweder auf eine beginnende Krankheit oder einen schlechten Traum zurückführte. Schlafbenommen lag sie auf ihrer Seite des Bettes und horchte auf das leise Rauschen des Meeres, von dem der leichte Widerschein eines silbrig-blauen Lichtes zu ihr drang. Erst nachdem sie ausführlich, doch noch ganz in der Trägheit des gerade Erwachten befangen, den Umstand erwogen hatte, dass das Meer sich nicht vor ihr, sondern vielmehr in ihrem Rücken befinden musste, hob sie den Kopf aus der Beuge ihres linken Armes etwas an und erkannte in dieser Stellung auch sofort in dem vermeintlichen Meeresrauschen ein kaum vernehmliches Geräusch, das von Helms Smartphone auszugehen schien, in dem vermeintlichen ozeanischen Silberlicht aber die Emanationen des LCD-Displays. Hinter dem Gerät aber erkannte sie die Züge des Mannes, mit dem sie einmal alt hatte werden wollen … – nun, das mochte etwas pathetisch sein, merkte sie sogleich selbstkritisch an: diese Überlegung hatten sicher nicht zu den erörterten Details ihrer damaligen Zukunftsplanungen gehört. Und dann hatte es eben nur für ein knappe Handvoll Jahre gemeinsamen Zusammenlebens gereicht, wohl vor allem aufgrund schwer definierbarer und noch schwerer zu vermeidender partnerschaftlicher Verschleisserscheinungen. Im Anschluss daran – während der darauf folgenden zweieinhalb Jahrzehnte also – war sie davon ausgegangen, im weiteren Verlauf ihres Lebens diesen Mann nie wieder zu sehen. Oder vielmehr hatte sie überhaupt nicht darüber nachgedacht, denn es war dies keine Hypothese, sondern eine Selbstverständlichkeit, die nicht überdacht werden musste und bereits deswegen dem Bereich der Gewissheiten zugeordnet werden konnte; genauso, wie sie kaum jemals ernsthaft darüber nachgedacht hätte, ob sie je einen Berg im Himalaja besteigen oder die mongolische Steppe zu Fuß durchqueren würde – es war davon auszugehen, dass diese hypothetischen Eventualitäten ihr wohl kaum in ihrer Lebenszeit widerfahren werde.
Nun aber lag dieser Mann wie all diesen Wahrscheinlichkeiten und überhaupt allem menschlichen Ermessen zum Hohn neben ihr. Er lag auf seiner Seite, doch ihr zugewandt, mit der rechten Hand das elektronische Kommunikationsgerät unweit vor seinen Kopf haltend, so, dass sie nur sein linkes Auge und die es umgebende Gesichtspartie zu sehen vermochte, die von einem diffusem, blassem Licht aus der sonstigen Dunkelheit gehoben wurde. Sie beobachtete, wie dieses Auge unermüdlich den oberen Teil des ihr nicht sichtbaren Bildschirmes abweidete und wie er in unregelmäßigen Zeitabständen die linke Hand unter seinem Kopf etwas vorschob um mit der Kuppe des Zeigefingers über den unteren Bereich jenes Displays zu schwingen, es dabei nur ganz sachte berührend, so, als würde er ein kleines Tier liebkosen oder auch mit einer unscheinbaren Bewegung den staunenswert gut ersonnenen Mechanismus eines Schwungrades in Bewegung setzen. Dabei vernahm sie ab und an sein trockenes, verhaltenes Husten der Nachtstunden. Einmal streckte er auch den Kopf näher zu dem Telefon hin, hauchte lange auf dessen Display (als würde es sich dabei um einen ihm über alles teuren Zauberspiegel handeln) und rieb anschließend das Gerät mit seiner Vorderseite einige Male rhythmisch über den Stoff seines Pyjamas. Da musste Isaura von Ramsperg unwillkürlich lachen, doch dieses Lachen war ein unhörbares, weil innerliches. In diesen Momenten entwarf sie in Gedanken das einfache Modell einer zukünftigen globalen Gesellschaft, die sich in eine Klasse oder gar gleich in einen Stamm der Wischer und in einen der Pfandflaschensammler gliedern würde, ähnlich den beiden Menschenrassen des Homo sapiens und des Neandertalers in ferner Vergangenheit. Und natürlich wäre den Flaschensammlern ganz so wie den Neandertalern keine besonders großartige Zukunft vorbestimmt… Danach überdachte sie die allgemeinere, ihr zumindest etwas weniger abseitig erscheinende Theorie, dass es im großen Ganzen nur zwei Kategorien von Sternen gab, unter die ein Menschenleben geraten könne: die tragische und die komödiantisch-ironische Kategorie. Und das Lebensschiff der Isaura von Ramsperg, die vom Geblüt her ganz sicher für den Stamm der Wischer vorbestimmt gewesen, doch aus innerer Neigung von jeher den Flaschensammlern zugetan war, segelte eindeutig unter einem Stern der letzteren Art. Diese notorisch hinterhältige Ironie (die unterschiedlos weder die Wischer, noch die Flaschensammler verschonte) mochte nicht immer leicht zu ertragen sein – auch jetzt noch traten ihr lebhaft ihre Leiden anlässlich der musikalischen Kompetitionen ihrer Jugendzeit vor Augen, die ihr letztendlich die ganze Sache auf Jahre und Jahrzehnte gründlich vergällt hatten. Doch dieser bittere Gedanke wandelte sich gleich danach zu einem Erstaunen darüber, wie sich – nach all dieser Zeit völlig unvermittelt und unverhofft – ein Fenster für sie geöffnet hatte, ein spezieller, maßgeschneiderter Vorhang war für sie aufgezogen worden. Wie durch ein gnädiges Berufungsurteil wurde ihr beschieden, nun doch noch genau das mit der Musik tun zu dürfen, was sie immer schon hatte tun wollen. Doch kam es natürlich in einer gänzlich anderen, unvermuteten Form daher, in einer komödiantisch-ironischen eben. Im Übrigen war sie sich gewiss, dass sie ohne diese frühe Leiden gar nicht imstande gewesen wäre, diese ihr schicksalhaft beschiedene Sonderregelung als Möglichkeit zu erkennen. Eine Virtuosin für Altennachmittage, dachte sie auch jetzt noch spöttisch-amüsiert, wie hätte man denn auch auf so etwas kommen können? Noch manches andere Lebensdetail fiel ihr ein, und allesamt wiesen sie darauf hin, dass ihr Leben unter jenem schalkhaften, gelegentlich gar dem Irrwitz zuneigenden Stern stehen musste, der sowohl dem tragischen, sowie auch jenem allzu glatten und routinierten Unstern – der dem Menschenleben noch als dritte und wohl gängigste Möglichkeit zur Disposition steht – bei weitem vorzuziehen sei.
»Was gibt es Neues?« fragte sie leise. Helm erschrak zuerst, doch dann fragte er leise, ob sie das wirklich wissen wolle. Sie seufzte nur. Daraufhin strich die Kuppe von Helms Zeigefinger einige Male rhythmisch und elegant nach oben. Eigentlich gäbe es nichts wirklich Neues, vermeldete er dann. Das mache nichts, dann wolle sie eben wissen, was es nichts wirklich Neues gebe, erwiderte sie gereizt. Also begann er damit, die Nachrichtenseite von oben nach unten rasch zu überfliegen, wobei er mit dem Zeigefinger nach jedem Satz in einer Abwärtsbewegung über das Display schnippte.
Heute sei die dritte Nacht der Unruhen in P., L. und M.; Plünderungen und hundertfache Festnahmen, vermeldete er als erstes und schnippte sodann verächtlich – Die zentrale europäische Rating-Agentur habe die nordamerikanischen Staatsanleihen erneut abgewertet und die südamerikanischen mit Ausnahme der brasilianischen auf Ramsch-Niveau heruntergestuft – Das Regime in H. hebe nach siebzehn Jahren den Ausnahmezustand auf und verspreche baldige freie Wahlen – Das oberste Religionsgericht in D. habe das Urteil der Steinigung für eine mutmaßliche Ehebrecherin bestätigt – Zweiter Tag der Geheimkonferenz von U., I. und E. über einen möglichen Militärschlag auf dubiose, möglicherweise atomare Anlagen in der Nähe von Z. – Finanzminister von S., L., L. und D. einigen sich über die künftigen Rahmenbedingungen für Kapitalflucht – Bombenanschlag auf internationales Hotel in N., ferner Selbstmordattentat auf einem Markt in B. – In T. erobern regierungstreue Truppen die Stadt T., eine Rebellenhochburg. Stark differierende Angaben über Opferzahlen – Der neue Film von E. (ein Katastrophenfilm, möglicherweise aber auch eine überaus subtile Satire auf dieses Genre) sei für den Oscar für den besten Film nominiert worden – R. (der weibliche Star der Kult-Fernsehserie G.P.D.P.) habe sich in Übereinstimmung mit ihrem Ehemann dazu entschlossen, noch vor Weihnachten ihren Brustumfang beträchtlich verringern zu lassen – Im i…ischen Fernsehen sei eine ganze Sondersendung einer sprechenden Katze gewidmet worden. Daraufhin meldeten sich im ganzen Land Tierhalter, deren Tiere angeblich sprechen, singen, tanzen und sogar mittelschwere Sudoku-Rätsel lösen könnten. –
Isaura von Ramsperg wartete noch etwas, doch dies schien die letzte Nachricht gewesen zu sein, die Helm als vermeldungswürdig befand.
»Oh«, sagte sie dann mit matter Stimme und schlief kurz darauf wieder ein.

IV.
Am Morgen des vierten Tages saßen Isaura von Ramsperg und Christoph Helm im Speisesaal, als ihnen die Diskussion zweier Hotelbedienter mit zunehmender Dauer lästig wurde. Den beiden Männern oblag es eigentlich, für die Vollständigkeit des Frühstücksbüffets zu sorgen. Die Fremden verstanden zwar nach wie vor kaum ein Wort der Landessprache, doch waren ihnen trotzdem klar, dass es bei dem Disput um Fußball gehen musste, denn wiederholt hörten sie die Namen der beiden beliebtesten Clubs des Landes fallen. Helm schloss deshalb auf eine gestrige Begegnung dieser beiden Mannschaften. Sie konnten sich an kein anderes Gespräch der Angestellten untereinander erinnern, dass einen privaten Charakter besessen haben könnte. Jedoch nicht nur allein dies war der Grund ihrer jetzigen Aufmerksamkeit; – es erstaunte sie vielmehr des weiteren, dass es sich bei dem einen der beiden grau Livrierten um jenen älteren Mann handelte, der ihnen bereits wiederholt aufgrund seiner besonders stoischen, unbewegten Haltung aufgefallen war, die ihnen bisher als geradezu exemplarisch für das hiesige Personal erschienen war. Mit strähnig über den Hinterkopf gekämmtem, lichtem Haar und einem versteinerten Ausdruck auf seinem lederartigen Gesicht, stand dieser Mann zumeist an einer Säule in der unmittelbarer Nähe des Empfangstresens. Man hatte dabei nicht den Eindruck, er würde an jenem Ort einer Betätigung nachgehen, er schien vielmehr einzig auf den Dienstschluss zu warten. Wer diesen Mann einige Mal dort so hatte stehen sehen, hätte ihn in der Tat wohl kaum eines so temperamentvoll ausgetragenen Wortgefechtes für fähig gehalten. Er fuchtelte dem jüngeren Kollegen – der entweder ein Anhänger des Konkurrenzvereines war oder aber auch nur eine unterschiedliche Meinung bezüglich des gestrigen Spiels vertrat, da war sich Helm nicht ganz sicher – fast ständig, wenn er sprach, mit ausgestrecktem Zeigefinger unter dessen Nase herum und seine Argumentation, vorgetragen in jener nasalen, schwerzüngigen und rätselhaften Sprache, besaß alle vokale Anzeichen von emotionaler Bewegung. Überdies schien er es zur Verstärkung seiner Worte auch noch für angezeigt zu halten, seinen Diskussionspartner aus weit geöffneten Augen anzustarren. Die wenigen Pausen in seinem Redefluss waren nicht etwa dafür bestimmt, dem Gegenüber Gelegenheit zur Darlegung seiner andersartigen Standpunkte zu geben, sondern vielmehr dem Umstand geschuldet, dass sie gerade eine ungebührliche, sicher sogar streng verbotene Handlung begingen, denn wann immer er schwieg, spähte er nervös um sich, ob sich ihnen auch kein Vorgesetzter nahe. Hatte er sich dessen vergewissert, wandte er sich mit einem jähen Ruck wieder dem Jüngeren zu, um ihn aufs Neue mit unwetterartigen Wortkaskaden zu überziehen.
Isaura von Ramsperg fand noch einen weiteren Anlass zur Verwunderung über das sich ihnen bietende Kammerspiel: Sei es nicht überaus merkwürdig, fragte sie Helm (und bei dieser scheinbar harmlosen Frage trat mit einem Male der ganze uralte Dünkel ihres Blutes zutage), dass das Land dieser Leute – allem zufolge, was man gerade so zu hören und lesen bekam – recht zügig vor die Hunde ging, jene beiden Landsleute dort sich aber in offenbar ungleich stärkerem Maße um die Geschicke ihrer Fußballclubs sorgten? Nein, das wäre gar nicht merkwürdig: die beiden seien eben dem Leben zugewandt, das wäre alles, beschied ihr Helm und klang dabei einmal mehr etwas unwirsch. Ihre Frage zeige überdies, fügte er hinzu, ihre völlige Unkenntnis dieses Sports und seiner Wirkkraft, denn es sei ja geradezu einer seiner Charakteristiken, dass seine Anhänger sich so eigensinnig und unmäßig für seine Geschehnisse zu interessieren pflegen, was immer sich auch gerade sonst noch in der Welt zutragen möge. Es könne sich dabei durchaus sogar um eine oppositionelle Haltung handeln, wenn diese wohl auch größtenteils eher unbewusst eingenommen werde. Ungeachtet dieser Ansicht fuhr Isa damit fort, jene Leidenschaft für bedenklich zu halten. Sie äusserte sogar die Meinung, dieser Sport nehme in gewisser Weise die Funktion ein, die zu früheren Zeiten die Religion besessen habe, Ruhigstellung und Ablenkung des Volkes nämlich. Darauf deute auch die enge Verzahnung von Politik und Sportfunktionären und seine staatliche Begünstigung hin. Sex sei auch eine Ablenkung und trotzdem möchte man ihn nicht missen, merkte Helm sarkastisch an und dachte dabei, er wusste auch nicht warum, an Robespierre. Isa schien diese Bemerkung als unsachlich einzustufen, denn sie ging mit keinem Wort darauf ein, befand vielmehr, es sei ungleich wünschenswerter, wenn sich die Bevölkerung gerade in Krisenzeiten wie diesen für Politik interessiere, ginge es dabei doch vor allem um ihre »ureigene« Zukunft. Eine der Charakteristiken der aktuellen Politik, zumindest der im europäischen Raum gepflogenen, dozierte Helm postwendend, sei es nun mal, dass sie in starkem Maße in einem abstrakten, in einem allenfalls von nebelhaften und euphemistischen Vokabeln definierten Territorium verbleibe, was viel stärker zu ihrem von interessierter Seite erwünschten Unbehelligtbleiben in ihrer Sondersphäre beitrage als sonst irgendetwas. Die Inflation und die sprunghaft steigenden Zinsen auf Darlehen für Immobilien seien alles andere als abstrakt, gab Isa zu bedenken. Das mochte so sein, doch von schockierender Neuheit sei das nun auch nicht gerade, sagte Helm und fuhr fort: bereits ihr recht übersichtlicher, im Großen und Ganzen wahrscheinlich nur von einer Handvoll Familienclans beherrschter Nationalstaat sei diesen Leuten ein Buch mit sieben Siegeln gewesen, vor dem man sich seit Generationen in Acht zu nehmen hatte. Wirklich gehört habe ihnen während all dieser Zeit nur ihre Fussball-Nationalmannschaft. Um wie viel fremder noch müsse ihnen nun dieses merkwürdig schimärenhafte Europa-Konstrukt erscheinen, das ihnen zu Zeiten von ihrer nationalen Elite als gelobter Kontinent angedient worden war, sich nun aber mehr und mehr als internationaler Langzeit-Survival-Camp für die unteren Klassen entpuppe. Selbst er, ein notorischer Leser von Zeitungen, die so anspruchsvoll seien, dass eine nach der anderen eingehe, würde sich mitunter die Frage stellen, ob es sich bei den Leuten des europäischen Verwaltungsapparates am Ende nicht doch um Ausserirdische handele, deren eigentlicher Auftrag ein ganz anderer sei. Und wenn es nur praktikabel wäre, hielte auch er es für keine schlechte Idee, das ganze Brüsseler Europa in kompakter Form wieder ins All zurück zu schiessen, und vielleicht – nach dem Verstreichenlassen des ein oder anderen Jahrzehntes – noch einmal ganz behutsam von vorne damit zu beginnen. Denn so wahnwitzig, wie es sich jetzt darstelle, könne das Ganze ursprünglich nicht gemeint gewesen sein; sie möge sich doch nur mal diese beiden Hoteldiener ansehen: seit Generationen schon hätten ihre Ahnen trotz und größtenteils gegen ihre jeweiligen Regierungen gelebt, sich durchgeschlagen, sich und ihre Kinder durchs Leben geschummelt. Vor gar nicht lang zurückliegender Zeit hätten diese beiden Individuen binnen Wochen den Niedergang eines politischen Systems, einer Weltanschauung erlebt, von der sie geglaubt hatten, dass ihre Kindeskinder einmal noch in ihrem Geiste erzogen werden würden. Gleich darauf wären sie auch schon von der freien Marktwirtschaft erfasst worden wie von einem Strudel. Sie wurden Europäer, ihren Gesellschaften wurde in Rekordzeit der Stempel eines ultra-doktrinären, beinernen Kapitalismus aufgeprägt, und nebenbei ging noch der globale Krieg gegen den Terror über sie hinweg: seitdem kämpften Landsleute von ihnen in irgendwelchen vorderasiatischen Gebirgen im Namen einer freien Welt, der offensichtlich vor allem am Export ihrer Automobile und am freien Zugang zu Rohstoffen gelegen sei. Und nun sähe es eben danach aus, dass die Implosion jener sogenannten Marktwirtschaft mitsamt des auf sie draufgepappten europäischen Kartenhauses bevorstehe. Da wäre es doch nur verständlich, dass man sich in diesen Zeiten um so inniger den wenigen verlässlichen Dingen zuwenden würde, wie es beispielsweise die jährlich stattfindenden nationalen und internationalen Fussballwettbewerbe wären. Ob sie, Isa, denn etwa glaube, dass diejenigen Ägypter des Altertums, die das Pech besessen hatten, dass ihre Lebensspanne in die Perioden sogenannter Zwischenreiche gefallen war, ihr Leben damit zugebracht hätten, darüber zu jammern in Zwischenreichen zu leben, die für die Nachwelt einmal lediglich schwarze Löcher der Geschichtslosigkeit darstellen würden? Und die zwei Livrierten dort würden sicher ebenfalls die Hoffnung und die Zuversicht hegen, es möge ihnen, wie auch schon den Millionen von Ägyptern längst vergangener Jahrtausende, irgendwie gelingen, einigermaßen unbeschadet dieses Scherbenfeld zu durchqueren, das sich vor ihnen erstrecke. Der Fußball und ihre sonstigen Belustigungen und Leidenschaften wären ihnen dabei behilflich, nichts weiter. Er, Helm, könne darin wenig Verwerfliches erblicken. Übrigens sei das, was da gerade mit solchem Getöse abschmiere nur der Staatenbund des internationalen Bürgertums – warum also sollten sich die Paria deswegen übermäßig beunruhigen? – Nun, auch die jeweiligen Unterschichten hätten von der europäischen Einigung nicht gerade wenig profitiert, wandte Isa ein, sie würde es beispielsweise nicht wundern, wenn auch dieses Hotel hier mithilfe europäischer Subventionen gebaut worden wäre. Die irgendeine internationale Holdinggesellschaft kassiert habe, ergänzte Helm achselzuckend: – Die europäischen Unterschichten hätten in der Tat schon von ganz anderen Regimes profitiert, doch Unterschichten seien sie dennoch geblieben. Sie sehe das eben als Mitglied der bürgerlichen Klasse, als Tochter eines Verwaltungsbeamten in gehobenem Dienst, später Akademikergattin. Er hingegen würde die Sache mit anderen Augen betrachten, er sei halt auch nur ein Abkömmling von Kleinbürgern, der dann auf eigene Faust wieder Paria geworden wäre, wenn auch ein etwas exotischer. Dabei stets beargwöhnt von den Behörden, denn so einen wie ihn dürfe es eigentlich gar nicht mehr geben, was ihm zuverlässig im Anschluss an jede seiner Steuererklärungen amtlicherseits bestätigt werde. Einzig das in seiner Werkstatt Befindliche wäre sein eigen und das habe ihm vor zwanzig Jahren schon gehört. Seine persönlichen Erwartungen an Europa aber würden sich im Grunde auf die Hoffnung beschränken, dass keiner seiner Beamten auf die Idee kommen möge, ihm die exakte Halslänge seiner Celli vorzuschreiben.
Auch Isa wurde nun lauter: wie er denn bitte dazu komme, ihren ehemaligen Ehemann zum Establishment zu rechnen, nur weil der Akademiker sei? Sein Leben lang habe jener für eine Pädagogik der Aufklärung gekämpft! Es mache sie traurig, aber auch wütend, zu sehen, mit welcher Inbrunst er, Helm, nach all den Jahren immer noch seinem Schubladendenken und seiner Schwarz-Weiss-Malerei anhänge, und das nur, um sich selbst und seinem vermeintlichen Underdog-Status zu huldigen, den er sein Leben lang schon vor sich hertrage wie ein Banner! Wie er sich immer noch in dieser unguten Mischung aus Überheblichkeit und Selbstmitleid als unverstandener Aussenseiter inszeniere, um seine Metzgersohn-Komplexe zu kompensieren! Und seine Manie, alles und jeden unter Generalverdacht zu stellen, seine paranoide Wahnvorstellung, die Welt habe nichts Besseres zu tun, als sich ausgerechnet und permanent gegen ihn zu verschwören. In Wahrheit sei ja wohl er der Spiesser! – So, so: ›Pädagogik der Aufklärung‹, wie? – giftete Helm mit der ostentativen Geringschätzung des Handwerkers für etwas, was er lediglich für ein professorales Steckenpferd hält: Das mache natürlich immer was her, ›die Aufklärung‹! Zu dumm nur, dass man die schon vor über zwei Jahrhunderten zu Tode geschleift habe, und seither tauge ihr klappriges Gerippe nur noch als Vehikel für wohlsituierte Gutbürger, die sich darin gefielen, im vollen Ornat ihres Samaritertums zu glänzen. Und stets wollten sie das Beste und stets wüssten sie, was dieses Beste sei! Und falls es doch noch mal dazu kommen sollte, dass irgendeine Kommission für europäische Musikinstrumente festlege, wie lange der Hals eines in Europa gebauten Cellos zu sein habe, dann würden selbstredend auch nur die besten und lautersten Absichten damit verbunden werden! Was ihn persönlich allerdings noch in Bezug auf ihren verflossenen Aufklärungspädagogen interessieren würde: habe der eigentlich einen roten oder einen schwarzen Volvo-Kombi gefahren? – Selbst wenn dadurch sein Weltbild ins Wanken geraten sollte: er fahre einen silberfarbenen Mercedes-Kombi! giftete Isa ihn daraufhin an. – Oha, da besäße er aber einen beachtlichen Mut zum Non-Konformismus, tat Helm überrascht, da könne er nur den Hut vor ziehen …
So wogte es noch eine Weile hin und her zwischen ihnen im fast leeren Speisesaal, während die beiden Hotelbediensteten am Büffet ebenfalls ausharrten und sich, wie man annehmen durfte, weiterhin über das nationale Fussballgeschehen ereiferten. Die beiden Urlauber aber fanden von den automobilen Vorlieben ihrer heimischen Akademiker bald wieder zurück zur Weltlage im Allgemeinen und den europäischen Perspektiven im Besonderen, doch weder bei dem einen, noch bei dem anderen konnten sie einen Konsens zu finden. Besonders Isa war es leid, immer zu hören, dass die Lage in Wahrheit noch viel schlimmer wäre, als man ohnehin schon angenommen habe.
Keine Stunde später standen sie nebeneinander in knietiefem Wasser den anlandenden Wellenfronten gegenüber und beratschlagten, ob sie es heute wagen sollten. Als sie sich endlich dafür entschieden hatten, hielten sie es für hilfreich, sich gegenseitig mit bibbernder Stimme ihre Überraschung über die »recht erträgliche« Wassertemperatur zu versichern. Die Sonne schien matt durch die löchrige Wolkendecke wie durch altersbrüchiges Milchglas, auch wehte den einsamen Badegästen immerhin ein gnädiger Westwind entgegen, dessen verhaltener Gesang allerdings ein ums andere Mal von dem Getöse der vor ihnen zerschellenden Wellen durchbrochen wurde. Als sie sich, Schritt für Schritt, bis auf wenige Meter vor die Wellenkämme vorgetastet hatten, standen sie schon bis weit über die Hüften im Wasser und wurden regelmäßig von der Gewalt der vor ihnen stattfindenden Eruptionen wieder einige Schritte nach hinten gedrückt, wobei vereinzelte Tropfen wie kleine Pfeile auf ihre Körper trafen. Isa kündigte daraufhin ihrem Begleiter an, sie werde wieder zurück an Land gehen. Nicht umsonst hätten sie bisher noch keinen einzigen Badenden im Meer gesehen! Helm erwiderte, es wäre wahrscheinlich in diesem Land eben nicht Brauch, im Meer zu baden, und watete tapfer einige Schritte weiter. Dann drehte er sich um und forderte sie auf, sich ebenfalls seitlich zu den Wellen zu stellen, da sie diesen dadurch weniger Angriffsfläche böte. Isa schloss widerstrebend und, wie es ihm schien, sogar leise fluchend zu ihm auf, stellte sich ebenfalls quer zum offenen Meer. Sehr nahe standen sie sich nun gegenüber. Isa hatte die Arme vor ihren Brüsten gekreuzt, die Hände auf ihre Schultern gelegt und sah ganz wie jemand aus, der schutzlos vor eine unbarmherzige Macht gezerrt worden war, vor der keine Aussicht auf Gnade bestünde. Helm war beinahe gerührt. Es gäbe nur drei Möglichkeiten, brüllte er ihr zu, wie man sich gegenüber einer Welle verhalten könnte: zum Einen könnte man sich ihr einfach entgegenstellen und sich von ihr hochheben lassen. Natürlich sei das nicht zu empfehlen, da man so von ihr mitgerissen und womöglich gegen einen Stein geschleudert werden könnte. Zum Anderen könnte man sich in sie hineinwerfen, wobei die Heftigkeit des Mitgerissenwerdens aufgrund der Gegenbewegung des Körpers zwar um Einiges geringer wäre, doch die Wahrscheinlichkeit, von ihr tüchtig durchgeschüttelt zu werden, wäre auch hier groß. Bliebe als Drittes noch die Möglichkeit, unter der Welle hindurch zu tauchen, und das sei natürlich die beste Variante! Man müsse einfach in dem Moment, in dem der Wellenbug seinen Zenit erreiche, vor ihm tief hinabtauchen, am Besten bis auf den Boden – dort unten wäre man noch vor dem gewaltigsten Brecher sicher und geborgen! Was er nicht sage! schrie Isa wütend zurück. Ob sie das kapiert habe? brüllte Helm. Doch da wusste sie bereits, dass ihr keine Zeit bleiben würde, ihm zu antworten, geschweige denn, umzukehren, denn in diesem Moment türmte sich vor ihnen eine Welle in gespenstischer Stummheit zu beängstigender Höhe empor. Jetzt! schrie Helm noch und war auch schon verschwunden. Sie folgte ihm gerade noch rechtzeitig, einen Wimpernschlag nur, bevor sie von dem Ungetüm erfasst worden wäre. Einen Augenblick später sah sie nur noch das wie von Milch durchflossene Weiss eines undefinierten, konturlosen Raumes vor sich. Es war eine stille, gar nicht unangenehme Umgebung, und sie verspürte keinerlei Angst in ihr. Ein fernes Grummeln drang ihr zu Ohren, deutlich spürte sie dabei, wie eine gewaltige Macht über sie hinweg ging, die ihr aber hier nichts anhaben konnte. Zwar wusste sie, dass dieser Vorgang nur einige Sekunden gedauert hatte, doch vermeinte sie, sehr viel länger in diesem bleichen, unstofflichen Reich verblieben zu sein; so, als würden hier unten andere Zeiteinheiten gelten oder vielleicht auch gar keine. Als sie wieder an die Oberfläche der ihr bekannten Welt gespült wurde, verspürte sie für einen Moment beinahe ein Bedauern, bevor die Erleichterung obsiegte, die matte Silhouette der Sonnenscheibe wieder über sich zu sehen und das ihr bekannte Felsmassiv zitternd darunter; auch hörte sie durch den Wind ein Klatschen, das von den Schwimmbewegungen Helms herrührte, der sich in geringer Entfernung von ihr befand. Sie solle sich bewegen! Schwimmen! Er schreit schon wieder, dachte sie enerviert, doch dann spürte sie die Eiseskälte, die bis zum Zentrum ihres Körpers vordrang und ihn zu lähmen drohte. Doch bald schon hatte sich ihr Organismus auf die Umgebung so weit eingestellt, dass der Kälteschmerz ein erträgliches Maß besaß. Es war ruhig hier, sanft wurden sie durch Wogen getragen und über Kuppen gehoben, je weiter sie hinausschwammen, um so besänftigter und wohlgesonnener schien das sie bergende Element zu werden; in der Art von großen, friedfertigen Organismen schien es sogar behutsam mit ihnen zu spielen.
Nachdem sie wieder festen Boden erreicht hatten, kauerten sie im feuchten Sand, hatten die Badetücher fest um sich geschlungen, saßen aneinander gelehnt. Sie schwiegen, spürten nur, wie ihre Körper sich erwärmten und sich der für ein Leben an Land gebotenen Temperatur annäherten.
Weil der Abend mild war, da das Auffrischen den Windes nach Einbruch der Dunkelheit an diesem Tag ausgeblieben war, setzten sich Isaura von Ramsperg und Helm nach dem Abendessen noch in einem an den Speisesaal angrenzenden Garten auf eine Veranda, die von einer Struktur aus Holzbalken überwölbt war, an der sich blühende Bougainvillea und Kamelien rankten. Der Nordwest trug ihnen über den Hotelquader hinweg das Meeresrauschen zu. Sie hatten sich eine Flasche Rotwein aus der Region bringen lassen. Helm hielt seit einiger Zeit seine Brille in den schräg einfallenden Lichtstrahl der Tischlampe neben ihm und beobachtete auf einer weissen Mauer in einigen Metern Entfernung den scharf geschnittenen Schattenriss derselben. Ihn verwirrte der Umstand, dass aus den beiden runden Schatten der Gläser jeweils ein feiner Lichtstrahl emporragte, der weit oberhalb von jenen und auf gleicher Höhe in jeweils einem vollkommen runden Lichtkreis seinen Abschluss fand. Interessiert hielt er seine Brille in unterschiedlichen Winkeln und Stellungen, doch die projizierte Form der Brille änderte sich nur unerheblich, und das Phänomen, das aussah wie die beiden Fühler einer Schnecke oder auch wie die Antennen von Ausserirdischen in Witzzeichnungen, blieb ebenfalls unverändert. Sieh an, sagte er sich, wieder mal eine Sache, für die es sicher eine exakte Erklärung gibt, welche ich mutmaßlich niemals kennen werde. Denn augenblicklich bin ich zu träge, um eine Suche im Netz anzustellen, und morgen werde ich diese kuriose Erscheinung wohl schon wieder vergessen haben. – Und während er sich einige Gedanken von ebenfalls flüchtiger Natur darüber machte, inwieweit er diese jüngste, zugegebenermaßen sehr spezifische, doch andererseits auch für den Rest seines Lebens andauernde Unwissenheit bedauern solle, hörte er zerstreuten Sinnes, wie Isa gerade ihr Befremden darüber äusserte, dass das, was die gegenwärtige Menschheit besäße, vor allem Maschinen wären, die ihr von Menschen gegeben wurden, die längst schon tot seien. Und leider bestünde der überwiegende Teil aus Maschinen und Technologien, die in fortschreitendem Maße die Welt der Heutigen zerstören würden. Das wisse eigentlich jeder, doch trotzdem könne kaum einer die Finger von ihnen lassen, was eigentlich erstaunlich sei; – sie müsse sich jedenfalls häufig über diese kuriose Konstitution des Menschen wundern, die ihm gestatte, über dieses Wissen zu verfügen und dennoch mit dem größten Gleichmut das Entgegengesetzte des eigentlich Angezeigten zu tun. Nun hätte Helm beim besten Willen nicht zu sagen gewusst, auf welchen verschlungenen Pfaden, an welchem Faden entlang Isa gerade zu diesen Bemerkungen gelangt war. So sagte er aufs Geratewohl und im Vertrauen darauf, dass es schon passen werde: das möge in der Tat häufig zutreffen, doch sie würde dabei die Eigenart von Maschinen übersehen, über ihre Schöpfer hinauszuweisen, – darin ähnlich den wichtigen und wichtigsten Erfindungen, die beiläufig, auf der Suche nach irgendetwas Läppischem, heute längst sich schon erübrigt Habenden, gemacht worden waren. Die Maschinen würden die Menschen daher auf lange Sicht hin formen, ihnen neue Bewegungen und Gedanken, vielleicht sogar neue Körper geben. Womöglich würden die Maschinen ihnen eines Tages auch die neuen Orte zeigen, an die sie fliehen könnten. – Maschinenromantik, befand Isa: Melancholie des Verschwindens, Utopien von post-apokalyptischem Weiterleben als Maschinenwesen … – Na, sagte Helm da leichthin, in dem Bemühen, ihre Unterhaltung aus solch trübsinnigen Untiefen zu manövrieren, er würde ja in gewissem Sinne ebenfalls sein Leben damit verbringen, Maschinen zu bauen, wenn diese allerdings auch aus Holz gefertigt seien … Da war Isa jedoch in Gedanken schon bei einem anderen Verschwinden. Leute wie sie beide, konstatierte sie, wären zwar noch existent, würden umherlaufen, in Urlaub fahren, lachen, streiten, miteinander schlafen und überhaupt ständig so tun, als ob es sie wirklich noch geben würde. Doch in Wahrheit seien sie längst schon verschwunden, und alles, was sie noch einigermaßen in der Welt hielte, wären ihre Erinnerungen und einige um diese herum gesponnenen Gefühle … – Helm, dessen Aufmerksamkeit seinerseits bereits von einem neuerlichen, doch ganz andersartigen Phänomen in Anspruch genommen worden war und der nur bei den Worten »miteinander schlafen« kurz aufgehorcht hatte, warf halbherzig und nicht sehr überzeugend ein, dass »Gefühle doch auch Realitäten« seien. Leute wie sie beide seien im Grunde nicht zukunftstauglich, fuhr Isa denn auch unbeeindruckt fort, nur unter Mühen hielten sie sich halbwegs in der Gegenwart. Sie jedenfalls scheue vor jedem Kontaktformular zurück, unmöglich sei es ihr, auch nur ansatzweise das Funktionsmuster ihrer Sprachbox zu verstehen, ihre Downloads gingen chronisch in den ihr unbekannten Galaxien der Festplatte verloren und bei dem Wort »Menü« würde sie nach wie vor ausschließlich an ein Abendessen denken. Helm, bereits ganz in der Beobachtung jener zweier Ameisenstraßen versunken, die sich auf dem Holzpfosten neben ihm in fortgesetzter vertikaler Bewegung befanden, lächelte bei ihren Worten amüsiert, denn er stellte sich vor, wie Isa sich wundern würde, wenn er ihr eröffnete, dass auch das Gespräch, das sie gerade führten, von ihm rein gewohnheitsmäßig mittels einer Audio-Recording-App seines Smartphones aufgezeichnet wurde. Ja, gestand er dann zu, ihre Zeit wäre in gewisser Weise sicherlich geprägt von einer Ästhetik des Verschwindens, alle Erkenntnis würde sich für gewöhnlich in dem Moment ihres Entstehens schon wieder verflüchtigen, würde überlagert und relativiert werden, doch das ändere nichts an der gelegentlichen Luzidität dieser flüchtigen Verbindungen, der eine neue Qualität von Schönheit zu eigen sei. Isa war sich indes sicher, dass spätere Generationen recht erstaunt auf die jetzigen zurückblicken würden, als auf Wesen, denen kurioserweise die eigene Gegenwart vorausgeeilt war, auf Wesen, die im Verlaufe von wenigen Dekaden ihre Welt in eine aberwitzige Beschleunigung zu versetzen gewusst hatten, um während der darauf folgenden Zeitläuften dieser verselbstständigten Entwicklung ohnmächtig und wie gelähmt hinterher zu schauen …
Helm besah sich unterdessen genau jene Stelle des Pfostens, an der sich die in unterschiedliche Richtung unterwegs befindlichen Ameisenstraßen stets und zuverlässig berührten. Dabei begegnete immer nur ein einziges Exemplar aus einem Zug einem des anderen, gegenläufigen Zuges. Ihm war, als ob bei diesem Zusammentreffen zwischen den beiden Tieren irgendeine Substanz, die er nicht zu erkennen vermochte, ausgetauscht würde, und zwar, unmittelbar bevor die beiden Insekten in der ihnen üblichen Unbeirrbarkeit und Eile ihren Weg fortsetzten. Auch dieses war ihm ein Rätsel. Die stetige Geschäftigkeit, die diesen Tieren eigen ist, hatte er stets schon mit einem gewissen Unbehagen, einem unbestimmten Grauen gar verfolgt, doch dieses Aufeinandertreffen mit anschliessendem Güteraustausch, das er nun verfolgte, versetzte ihn in einen Zustand der Fassungslosigkeit … Das komme daher, überlegte Isa währenddessen laut, dass die Angst, die unsere Vorfahren noch vor dem Leviathan besessen hätten – jener Macht, die sie sich als gänzlich ausserhalb ihres Einflussbereiches angesiedelt vorstellten – grundlegend gewandelt habe. Diese Angst habe sich damals immerhin teilweise auch produktiv ausgewirkt, man sei durch sie zu Erkenntnissen gekommen, die generiert worden seien von dem Willen, nicht nur das eigene Leben, sondern nach und nach möglichst weite Teile des Universums vernünftig zu ordnen, um so den Machtbereich der Bestie einzugrenzen, ihr etwas von ihrem Territorium zu entringen. Doch die Generationen der Gegenwärtigen hätten längst verinnerlicht, dass dieser Leviathan in ihnen selbst beheimatet sei, dass aus ihnen selbst das Grauen komme, der Keim der Sinnlosigkeit von Allem, und daher komme sicher auch all die Ohnmacht, Unordnung, Lähmung, die Resignation …
Helm aber lag der Leviathan gerade eher fern: Wenn die jeweilige Ameise tatsächlich etwas auf-, etwas entgegennähme, bevor sie ihren Weg weiter verfolge, der, wie man vermuten könne, zu ihrem Bau führte: – welches Gut würden dann aber diejenigen ihrer Artgenossen ihnen zutragen, die aus umgekehrter Richtung, also aus ihrem Bau heraus, nach oben strebten? Würde es sich dabei um einen von dem ersteren Stoff unterschiedlichen handeln oder nicht etwa doch um genau jene Substanz, die vordem unter Mühen von Mitgliedern der anderen Straße ins gemeinsame Lager verbracht worden war? Helm schwindelte etwas und er hätte dies nur zu gern dem Wein zugeschrieben. – Doch wo viel Gefahr wäre, wäre auch viel Hoffnung, versuchte Isa sich unterdessen in Optimismus. – Wo viel Gefahr wäre, wäre zunächst mal viel Gefahr und sonst gar nichts, versetzte Helm beiläufig; diese Replik bot sich ihm gerade an. Er fühlte sich nicht sehr gut. Dieser naive Glaube, fuhr er fort, dass es kein Ende geben könne, nur weil man unfähig wäre, die Anfänge zu erkennen, erschiene ihm als typisch für diese nostalgisch-humanistische Verblendung, für jenen Kinderglauben, demzufolge nicht sein könne, was nicht sein dürfe. Dann hing er weiter seinen eigentlichen Überlegungen nach, streckte den Kopf etwas weiter dem Balken entgegen, um so vielleicht doch etwas über die Art des Güteraustausches in Erfahrung bringen zu können. Es gelang ihm jedoch nicht, auch nur ein Winzigstes zwischen den Zangen der Insekten zu erkennen, es war ihm, als würden sie sich gegenseitig mit imaginären Gaben beschenken, als würde es sich gar um einen rituellen Austausch handeln… Er schüttelte den Kopf und goss sich noch Wein ins Glas. Isa berichtete ihm gerade – warum auch immer – von Gräfinnen des 14. Jahrhunderts, die tränenreich ihren nicht standesgemäßen Liebhabern entsagt hätten, ferner noch von den Wünschen, den Hoffnungen, den Lebensschmerzen von Bauernmägden des 17. Jahrhunderts. Helm schüttelte erneut den Kopf, ergriff sein Glas, dachte weiter über die Natur, Konstitution und Verfassung von Ameisen nach, während Isa bedauerte, dass es den Heutigen nicht gegeben wäre, all die immensen Mengen von Glück, Schmerz, Trauer, Leid all jener längst schon zu Staub verfallenen Artgenossen zu subsumieren. Es müssten dies unvorstellbare Mengen sein – wenn man doch nur eine Maßeinheit für solche Dinge besäße!
Helm hatte es inzwischen aufgegeben, ihre Ausführungen folgen zu wollen. Der Abend entglitt zusehends seinem Intellekt. Mit einem süffisanten Lächeln gedachte er seiner früher einmal gehegt- en Hoffnung, dass sich die Masse des Unverstandenen zwangsläufig mit der Zahl der Lebensjahre verringern müsse. Andererseits hätte er auch nicht mit Bestimmtheit zu sagen gewusst, ob er – nun, da er vor dem Trümmerhaufen dieser Hoffnung stand – wirklichen Schmerz darüber verspürte oder ob es sich dabei nicht etwa wieder mal nur um eine der so zahlreichen und mit zunehmendem Alter immer häufiger auftretenden Koketterien des Gefühls handelte.
In jener Nacht hatte Helm einen Traum, in dem er Abschied von der Akademie feierte. Das Fest fand in einer zum Wasser hin offenen Halle an einem Fluss statt. Es erstaunte ihn, wer nicht alles gekommen war, um sich von ihm zu verabschieden: Es waren Menschen darunter, die er seit so langer Zeit nicht mehr gesehen hatte, dass er sie kaum noch erkennen und seinen Lebensepochen zuzuordnen vermochte: Nachbarn aus seiner Kindheit, Lehrer aus der Grundschule, Kameraden aus dem Sportverein. Manche schauten ihn mit einer Scheu an, die sich gelegentlich mit einer ihm nicht ganz verständlichen Bewunderung zu vermischen schien. Einige trauten sich nicht einmal, das Wort an ihn zu richten. Er war ständig von so vielen, ihn beglückwünschenden Gästen umringt, dass er viele dieser stillen Gäste zwangsläufig übersah. In weit fortgeschrittener Nacht erst, als er nur noch ganz alleine in der festlich geschmückten Halle saß, fand er Muße, ein wenig über seine Zukunft nachzudenken, die – nun, da er den Schutz der Institution verlassen würde – offen und ungewiss vor im lag. Da wurde ihm mit einem Mal klar, dass alle diese Leute nicht gekommen waren, um seinen erfolgreichen Abgang von der Akademie zu feiern, sondern um eines ganz anderen Abschiedes willen.–
Der Schrecken dieser unvermittelten Erkenntnis liess ihn wohl erwachen, doch möglicherweise war es auch Lauten geschuldet, die er zu vernehmen glaubte. Traumbenommen wie er war, konnte er dieses Krächzen zunächst nichts und niemandem zuordnen, dennalles, was er jetzt hörte, war das Meer und die leisen und regelmäßigen Atemgeräusche des Körpers neben ihm. Endlich erhob er sich und trat zum Fenster. Das Meer war ein stiller Spiegel unter einer fast vollständigen Mondscheibe. Die Felsen auf dem Geröllfeld vor dem Strand warfen unter seinem Licht scharfe, düstere Schatten. Je länger er zum Fenster hinaus auf diese leere Nachtlandschaft sah, desto ruhiger wurde es in ihm. Als er den Blick nach oben hob, hatte er schon vergessen, warum er an das Fenster getreten war. Da sah er, unterhalb von Sternen und schnell ziehenden Nachtwolken, die schwarzen Umrisse von großen Vögeln, die in kompliziert erscheinenden, von menschlicher Intelligenz eher nicht zu durchschauenden Anordnungen über dem Hotel kreisten.

V.
Am Morgen des fünften Tages erzählte Helm beim Frühstück von seinem Traum, auch von dem Vogelschwarm, den er nach dem Erwachen am Nachthimmel beobachtet hatte. Isa stellte daraufhin die pragmatische, arglos gemeinte Frage, ob diese Vögel nicht vielleicht auch Teil und Abschluss seines Traumes gewesen sein könnten. Ihr selbst sei es schon oft widerfahren, dass sie geträumt habe, sie sei aus einem Traum aufgewacht, und was sie danach für die Wirklichkeit gehalten habe, sei in Wahrheit nur die Überleitung in ein neues Kapitel des Traumes gewesen. Im Übrigen würden die großen schwarzen Vögel von der Symbolik her gut zu dem Vorhergehenden passen. Helm starrte sie wortlos an und sie vermeinte förmlich zu sehen, wie sich seine Laune wieder einmal zügig umschattete. Auch sie würde sich in letzter Zeit vermehrt die Frage stellen, fuhr sie eilig fort, was sie denn jetzt noch beginnen könnte mit ihrem Leben, ob noch genug Zeit bliebe für einen Neuanfang, ganz abgesehen davon, ob man denn überhaupt noch die Kraft und das Vermögen für einen solchen haben würde. Oft wünschte sie sich in einer sie fordernden Kontinuität zu stehen, so wie er, Helm, der – gleichgültig, ob gerade mal wieder eine seiner Beziehungen in die Brüche gegangen war – einfach in seine Werkstatt ginge und weiter arbeite. Auch sie wünsche sich mitunter, über eine derartig simple wie wirksame Therapie zu verfügen … So redete sie in einem fort und verwunderte sich, wie Helms Miene zunehmend finsterer wurde, ja wie der ganze Mensch endlich wie völlig in sich eingesunken vor ihr saß, obwohl doch ihre Worte ihm und seiner von jeher großen Geltungsbedürftigkeit eigentlich hätten schmeicheln müssen. Wenn sie hingegen auf ihrLeben zurückblicke, erschiene es ihr wie eine stetige Abfolge Zufälligkeiten. Diesen Abgründen des Fragmentarischen, in die fast jeder früher oder später einmal zu blicken habe, hätte er, Helm, sich mit einem schlichten, doch effektiven Trick entzogen, durch die Materialisierung seiner Ambitionen nämlich, die nach Fertigstellung nur kurze Zeit in seinem Instrumentenschrank stünden, bevor sie »in die Welt gingen« und Platz für neue schafften…
Da hielt sie endlich inne, sei es, weil ihr der Faden ihres Vortrages verloren gegangen war, sei es, weil sie erkannt hatte, dass der Mensch vor ihr, der Gegenstand ihrer Eloge, mittlerweile wie zu Stein geworden war. Gerade noch hatte er, wenn auch mit umwölkten Blicken, durch das große Fenster des Speisesaales auf das heute morgen wieder mattgraue, doch bewegte und unentwegt weiss-schaumige Kronen spuckende Meer in der Ferne geschaut, immerhin war er noch den wie belebt erscheinenden Nebelgespinsten, die über das Wasser weg in das Land hasteten, mit halbwegs interessiertem Blick gefolgt – nun aber saß er stumpfäugig und matt vor ihr. Sie beschloss, ihn ein wenig in dieser Stimmung zu belassen, doch nicht zu lange.
»Gehen wir heute also wieder an unseren Privatstrand?« rief sie dann, und ihre Stimme klang fröhlich, fast ausgelassen. Ihr Lächeln war breiter geworden, es schien Helm, der sie überrascht, fast erschrocken musterte, als würde sich ihr Mund beinahe über ihr ganzes Gesicht dehnen. Man wurde einfach nicht schlau aus ihr. Stumm hob er die Schultern um sie gleich wieder fallen zu lassen, was Isa als Zeichen der Zustimmung deutete.
Um die Mittagszeit dann saßen sie auf zwei hüfthohen Steinen, die sich in geringer Entfernung von- einander über dem Strand erhoben. Man hätte glauben können, dass jemand diese Steine wie Requisiten inmitten des feuchten Sandes aufgestellt habe, nur damit diese beiden einsamen, in der unwirtlichen Küstenlandschaft wie verlorenen Gestalten darauf so etwas wie einen Halt, eine temporäre Bleibe finden konnten. Sie saßen der See zugewandt, wie Menschen von jeher an den Ufern der großen Gewässer nur diese Blickrichtung zu kennen scheinen. Der Nebel hatte sich verdichtet, war zu einer grau-braunen Wand geworden, die sich in einiger Entfernung dort draussen auftürmte. Aus ihrer Mitte brachen Fetzen unterschiedlichster Gestalt hervor, zumeist längliche Gebilde mit zerklüfteten Umrissen. Sie glitten in niedriger Höhe auf die beiden Urlauber zu und über sie hinweg, geschmeidig wie Kundschafter, oder auch wie Jäger, die ausgesandt waren, Beute zu machen. Keiner von beiden hatte es für nötig befunden, Badekleidung und Strandtuch einzupacken, ihnen wäre es an diesem Tage nicht einmal im Traum eingefallen, ein Bad zu nehmen. Isa war Helms ungewöhnlich lange anhaltendes Schweigen nicht geheuer. Überhaupt nahm sie ihn an diesem Tage als eine Person wahr, mit der zwar verblichene, ferne Erinnerungen verwoben waren, von denen sich jedoch nur sehr vereinzelte Fäden zu seiner jetzigen Erscheinung fortspannen. Zu dieser Fremdheit gegenüber ihrem Reisegenossen passte auch gut das unwirkliche Empfinden jener letzten Tage, die ihr wiederum wie ein Sinnbild, ein Brennglas erschienen, in dem sich das gegenwärtige Stadium ihrer Existenz verdichtete.
»Du scheinst dir Illusionen über mich zu machen, Isa«, richtete Helm endlich das Wort an sie, ohne den Blick von den grau anlandenden Wellenreihungen zu nehmen. »Was ich tue, das tue ich, um etwas zu tun, doch tue ich es, ohne eigentlich zu wissen, warum ich es tue. Alles was ich weiss, ist, dass ich etwas tun muss um nicht vor die Hunde zu gehen …«. Anlässlich dieser redundanten Ansprache fiel Isa vor allem auf, wie selten sie sich von jeher bei ihren jeweiligen Vornamen genannt hatten. Bei ihren Nachnamen freilich noch viel weniger. Sie sagten einfach Du zueinander, so, als würde es für ihren Umgang miteinander ohnehin keine passenden Namen geben. Tatsächlich hatten sie, soweit sie sich erinnerte, immer nur in besonderen Situationen ihre Vornamen bemüht.
»Darüber würde ich mir keine Sorgen machen«, sagte sie daraufhin und fügte dann versuchsweise hinzu: »Christoph … « – doch sie schien das nicht besonders überzeugend zu finden. »Was du gerade unter einer inflationären Verwendung dieses Hilfsverbs beschrieben hast«, fuhr sie fort, »ist das durchaus gängige Lebensmodell, sogar unter fortgeschrittenen Usern.« – ›Hilfsverb‹ dachte Helm da, mit einer unklar zusammengesetzten Gefühlslage im Hintergrund, in der sich Spott und Bitterkeit mit einer grundsätzlichen Sympathie die Waage zu halten schienen, ›und im gleichen Atemzug dieses manieriert-artifizielle, gar nicht zu ihr passende, irgendwo aufgeschnappte User! Sie kommt wirklich noch aus dem neunzehnten Jahrhundert, eigentlich sollte sie Reifröcke tragen und mit anderen Freifräuleins in Parks sitzen und Blumenkränze flechten … ‹
Unterdessen hatten sich die beiden dunklen Punkte, die unlängst durch die Nebelwand vor ihnen gestossen waren, so weit genähert, dass Isa in ihnen große Ruderboote zu erkennen glaubte, da sich über ihrer Sichelform keinerlei Aufbauten erhoben. In gleichbleibender Distanz zueinander näherten sie sich langsam der Küste. Isa wühlte in ihrem Rucksack und setzte gleich darauf ihr Fernglas an die Augen. In einer fast unnatürlichen, traumhaften Nähe, so etwa, als würde sie durch ein Mikroskop Mikro-Organismen von bizarrer Form und wunderlichem Betragen beobachten, sah sie nun auf mit Kapuzen bedeckte Köpfe, die nur knapp über die Bordwand des von ihr anvisierten Fahrzeugs ragten. Etwas erhöhter saßen die Ruderer, es waren sechs auf jeder Seite. In der Nahsicht war auch zu erkennen, wie stark der Seegang dort draussen war; der Bug des Bootes war mitunter beim Durchfahren eines Wellentales so sehr nach unten geneigt, dass sie bei dem kurzen Blick, den sie dabei auf das Deck gewann, verschiedenartige Gegenstände wie Rettungsringe, Taue und eine große Anzahl röhrenförmiger, schwarz glänzender Packen erkennen konnte. Helm fragte sie, ob das wohl Fischer sein könnten. Sie hob daraufhin kurz die Schultern und richtete das Glas auf das zweite Fahrzeug, das ihr wie eine Doublette des ersten erschien; erst jetzt fiel ihr aber auf (eigentlich nahm sie es vielmehr wie eine Selbstverständlichkeit zur Kenntnis), dass es sich bei den Insassen der Boote ausschliesslich um Männer zu handeln schien. Immer noch wortlos reichte sie daraufhin das Fernglas Helm hinüber, fixierte dann bloßen Auges die beiden Boote, die ohnehin ständig an Kontur gewannen. Leicht gereizt registrierte sie, wie Helm nach dem Anlegen des Fernglases sofort damit begann, an dem Justier-Rad zwischen den Zylindern zu drehen. Er brauche da nicht so hektisch zu kurbeln, sie habe es bereits auf optimale Sicht eingestellt, wies sie ihn zurecht. Helm erwiderte darauf nichts, stöhnte nur leise. »Lass‘ uns von hier verschwinden«, bat Isa, doch diese Bitte klang mehr wie ein Marschbefehl. Helm setzte den Feldstecher ab, um sie fragend anzusehen. »In den Booten sind nur Männer … und das sind ganz bestimmt keine Fischer«, erläuterte sie, doch sein fragender Blick hielt an. Weder das eine noch das andere spräche grundsätzlich gegen sie, befand er dann, und gab damit nebenbei auch zu verstehen, dass er den Fortgang dieser Geschichte mitzuerleben wünsche. Unterdessen waren die beiden Boote fast in den ruhigeren Wassern vor der Küste angekommen. Isa musste sich eingestehen, dass sie durch einen überstürzten Aufbruch die Bootsbesatzungen erst recht auf sich aufmerksam gemacht hätten. Helm nahm noch einmal das Fernglas vor die Augen, wobei seine Finger sich erneut am Justier-Rad betätigten. »Diese Sache da ist mir auch nicht geheuer«, murmelte er, »ich bin auch gar nicht mal so neugierig, was es damit auf sich hat. Allerdings habe ich das Gefühl, der Zeitpunkt, zu dem man sich noch eilig davonmachen gekonnt hätte und dabei so tun, als ob man nichts gesehen hätte – dieser Zeitpunkt ist längst vorbei.« Mit diesen Worten nahm er das Fernglas endlich von den Augen und gab es seiner Besitzerin zurück. Es war ohnehin nicht mehr vonnöten, denn sie vermochten mittlerweile mit bloßen Augen sogar die in Schollen abblätternde weisse Farbe am Bug des vorderen Bootes zu erkennen; dabei fiel ihnen auf, dass kein Name oder eine sonstige Kennzeichnung auf den Bootsrümpfen zu sehen war. In dem Maße, in dem von den Fahrzeugen Geräusche über das Wasser zu ihnen drangen – zwar keine Stimmen, sondern vielmehr das Krächzen der Riemen in den Dollen und das leise Klatschen, das die Blätter bei ihrem Eintauchen in das Wasser verursachten, auch das Ächzen der Planken, das von den beim Pullen gegen sie gestemmten Füßen der Ruderer herrühren mochte –, in dem Maße gewann die Szenerie, die vordem noch eher wie eine Vision oder ein Trugbild anmutete, an Wirklichkeit. Die Boote waren von ungewöhnlicher Größe und den Rettungsbooten auf den transatlantischen Passagierdampfern des frühen 20. Jahrhunderts ähnlich. Aufgrund der Verhüllung durch die weiten Kapuzen der Ölmäntel vermochte man kaum individuelle Gesichtszüge bei der Besatzung zu unterscheiden. Isa erlebte diese Konkretisierung der Lage als zwiespältig: einerseits wurde sie dadurch ruhiger, andererseits bewirkte die bevorstehende, unabwendbare Landung mit all ihren Unwägbarkeiten eine Verstärkung des bangen Gefühls in ihr. Schon erhoben sich die ersten Männer, stiegen mit bedächtigen über Bord, liessen sich in das Wasser gleiten, das ihnen bis zur Hüfte reichte. Die Ruderer holten die Pinnen ein, warfen Taue über Bord und folgten nach. Vor jedem der Boote watete nun eine lange Reihe von Männern gegen den Strand hin, die Taue auf den Schultern, den Oberkörper von der gemeinschaftlichen, nicht nur wort- sondern beinahe sogar lautlosen Anstrengung nach vorne gebeugt. Ihr Ölzeug war von grauer oder auch blauer Farbe. Als die Bootsrümpfe unter lautem Knirschen über Sand liefen, verstärkte sich die gebückte Haltung der sie ziehenden Männer noch einmal. Schliesslich, als die ersten in den Reihen der Schlepper nur noch wenig mehr als zwanzig Meter von ihnen entfernt waren, liessen sie die Taue wie auf ein unhörbares Kommando hin fallen und brachten so die Fahrzeuge zum Stillstand. Jeder der Männer griff sich nun aus dem Inneren der Boote einen der schwarzen Packen hinaus. Sie waren oben mit einer Kordel verschlossen, und Helm und Isa sahen, dass es sich dabei um besonders große, bis oben gefüllte, doch trotzdem stabile Müllsäcke aus schwarzem Kunststoff handelte. Die Ankömmlinge schulterten ihre Bündel und in neuerlicher gebückter Haltung gingen sie langsam, in loser, ungeordneter Folge den Strand hinauf, auf die beiden Touristen zu, die unbeweglich wie Statuen auf ihren Steinen saßen. Dass jene auch jetzt wieder kaum eines Gesichtes aus der Gesellschaft näher ansichtig wurden, lag nur bedingt an der gebückten Haltung der Träger und ihren auskragenden Kapuzen, die sie auch an Land nicht abnahmen, sondern mehr noch an einer Art von instinktivem Taktgefühl, das die beiden dazu veranlasste, vornehmlich ins Unbestimmte vor sich zu blicken und jede ausführliche, neugierige Musterung einer der sich ihnen nähernden Gestalten tunlichst zu vermeiden. Ausdrücklich bewusst schienen die zwei Pauschalurlauber sich dessen zu sein, dass sie dort, an jener Stelle und zu jener Stunde, eigentlich nicht hätten sein sollen. Da sie nun aber einmal anwesend waren und ihre Zeugenschaft nicht ungeschehen machen konnten, so trachteten sie doch danach, diese immerhin möglichst beiläufig erscheinen zu lassen. Fast hätte man denn auch glauben können, ihre Körper wären Bestandteile der Topographie jener Landschaft, wie die Felsen, auf denen sie saßen, oder der spärliche Bewuchs der Dünen. Die Männer ihrerseits schienen dieses distinguierte Verhalten der beiden Touristen durch ein ostentatives Desinteresse ihnen gegenüber zu würdigen. Schweigend und blicklos zogen sie seitwärts an den Steinen vorbei; ja einer von ihnen schien zunächst sogar Anstalten zu machen, durch die nicht allzu breite Lücke zwischen Isas und Helms Platz hindurch zu gehen, besann sich zuletzt dann wohl doch noch anders und ging an Isas rechter Seite vorbei, jedoch so nahe, dass sie ihn ohne Weiteres an der Schulter hätte berühren können. Nach wie vor fiel kein einziges Wort auf der einen wie auf der anderen Seite. Auch im Nachhinein wunderte sich Helm noch, wie sehr diese Begebenheit, die doch eigentlich von einem bedrohlichen Charakter hätte sein müssen, immer eindeutiger umschlug in eine zwar zweifellos eigentümliche Begegnung, die jedoch von einer merkwürdigen, ihm bis dahin unbekannten Art einer respektvollen, einverständlichen und gegenseitigen Ignoranz geprägt war. Als die letzte der Gestalten sie passiert hatte, wandten sie die Köpfe und blickten der Gruppe, deren Vorhut sich bereits zwischen den ersten Steinaufhäufungen verloren hatte, nach. Einige Zeit danach verliessen sie endlich ihre hohen Sitze, um zu den verlassenen Booten zu gehen. Sie waren, bis auf die Ruder und die Taue, gänzlich leer. Isa stand eine Weile vor dem hohen Bug des einen der Boote und zog gedankenverloren kleine, sich zu den Rändern hin kräuselnde Farbinseln von seinem Holz, um sie anschliessend dem Wind zu übergeben, der sie ein Stück den Strand hinauf trug. Später, als sie sich auf dem Weg zu dem Hintereingang ihres Hotels befanden, sahen sie die Fußspuren der Ankömmlinge im Sand, die in Richtung eines Hügels führten, hinter dem die Küstenstraße lag. Sie nahmen das unabhängig voneinander zur Kenntnis, während sie schweigend nebeneinander gingen. Als Isa Helm überreden wollte, mit ihr am späten Nachmittag den Shuttle-Bus des Hotels zu nehmen, um sich in der Stadt »etwas «, lehnte der das rundweg ab.
Helm ging an diesem vorletzten Abend ihres Aufenthaltes früh zu Bett. Er verspürte eine Müdigkeit wie nach einem anstrengenden Arbeitstag. Das Letzte, was er vor dem Einschlafen wahrnahm, war seine Begleiterin, die, in ihren viel zu großen Pyjama gehüllt, auf einem der schweren Polstersessel am Fenster Platz nahm und unter dem Schein einer Stehlampe ihr Buch aufschlug.
Es ging schon gegen Morgen, als er mit Harndrang erwachte. Er begab sich in das Badezimmer und einer langen Gewohnheit in jenen Situationen folgend, verzichtete er auf das Entzünden eines elektrischen Lichtes. So saß er dort, und in dem Maße, wie er zur Gänze erwachte, irritierte ihn der Spielzeug-Frosch, der unverändert auf dem kleinen Schrank der Toilette gegenüber saß. In dessen Innerem – das war das eigentlich Befremdliche – blinkte es seit Tagen schon zuverlässig und in regelmäßigen Abständen. Er nahm die Figur schliesslich etwas ungehalten an sich, drückte mit einem Daumen und dann auch mit einem Zeigefinger auf ihrem Bauch und Rücken herum, doch gelang es ihm nicht, den Leuchtmodus zu deaktivieren. Also stellte er den Frosch zurück und starrte noch ein Weile auf ihn, während dieser fortfuhr, seine Leuchtsignale in die Dunkelheit zu senden.
Als Helm in das Zimmer zurück gekommen war, horchte er einen Augenblick auf den gleichmäßigen Atem Isas und ging dann zum Fenster, wobei er sich unterwegs die nackten Zehen an einem harten Gegenstand stiess. Er bückte sich, tastete nach ihm und erkannte, dass es sich dabei um Isas Buch handelte. Vergeblich versuchte er, sich an den Autor oder zumindest den Titel zu erinnern. Es handelte sich um einen Kriminalroman, das wusste er immerhin noch. Er selbst hatte in seinem ganzen Leben noch keinen Kriminalroman gelesen und würde es vermutlich auch nie tun. Am Fenster angekommen, zog er behutsam den schweren Vorhang zurück. Obwohl der Monat auf seinen Vollmond zugehen musste, vielleicht ihn in dieser Nacht schon erreicht hatte, war dort draussen nicht gerade viel zu sehen, denn das Mondlicht drang nur schwach durch eine fast geschlossene Wolkendecke. Das Rollen der Wellen war zwar hörbar, indessen waren sie von hier oben kaum auszumachen. Sogar die weit gestreuten Gruppen der Steine hinter dem Strand zeichneten sich nur undeutlich von dem sie einbettenden Sand ab, all das war mehr oder minder Schwarz in Schwarz. Wie häufig in Situationen, in denen seine Sinne kaum in Anspruch genommen wurden, begann Helm über sich und sein Leben nachzudenken, wenn er das auch in dieser Nacht lustlos, beinahe widerwillig tat. Ob er auf ein im großen Ganzen gelungenes Leben zurückschauen konnte, hätte er nicht zu sagen gewusst, immerhin schien es ihm bis jetzt recht eigenartig gewesen zu sein. Er vermutete allerdings, dass das fast jeder von seinem eigenen Leben annahm. Als er den Blick hob, bemerkte er, dass sich um den Quader des Hotels die Wolkenschichten etwas geöffnet hatten; am Himmel dahinter glommen die Sterne. Doch so angestrengt er auch hinauf spähte: in dieser Nacht kreiste kein Vogelschwarm über dem Hotel. Weit davon entfernt zu wissen, warum das so war, schlug ihm das Ausbleiben der Vögel seltsam aufs Gemüt. Einen Augenblick noch presste er seine Stirne auf das kalte Glas, dann ging er hinüber zu seiner Seite des Bettes, wobei er sich erneut auf recht schmerzhafte Weise die Zehen an dem auf dem Boden liegenden Kriminalroman anschlug.

VI.
Am Morgen des sechsten Tages wurde Isa von Ramsperg durch einen bereits fortgeschrittenen Penetrationsversuch ihres Begleiters geweckt. Zuerst liess sie ihn gewähren, während sie überlegte, was hier zu tun sei: Sollte sie es über sich ergehen lassen – aus Mitleid, aus Sympathie, um des guten Einvernehmens willen, oder aus welchen Gründen auch immer man sich ohne eigenes Begehren oder dringliches Interesse auf einen Geschlechtsakt einlassen könnte? Sie erwog daraufhin, so gut sie es in ihrem Zustand des unmittelbar Erwachtseins vermochte, ihre Stimmungs- und Gemütslage dahingehend, ob es tatsächlich auszuschließen sei, dass nicht auch sie noch im Verlauf des Geschehens Lust verspüren könnte. Sie kam zu keinem Schluss darüber, und dann war es vor allem das Zusammenwirken des abscheulichen Gefühls, so willenlos und nahezu apathisch dazuliegen, mit dem schwerem Atem des erregten Mannes hinter sich, und dem grellen Schmerz im Unterleib, den er ihr verursachte, das sie endlich dazu veranlasste, ihren Oberkörper etwas nach hinten zu drehen und jenen Körper, der sich an ihr zu schaffen machte, von sich zu stossen. Wie es nicht anders zu erwarten war, lag Helm im Anschluss daran bewegungslos auf seiner Bettseite, von ihr abgewandt, während sie nach Worten suchte, die abwiegeln, deeskalieren, das Heillose der Situation zumindest auf ein erträgliches Maß herabmindern könnten. Obwohl Isa keine Erklärung oder gar Entschuldigung von ihm verlangt hatte, gab Helm vor, in einer Art von Wachtraum gehandelt zu haben. Sie wusste, dass das eine Lüge war, begnügte sich aber mit der Erwiderung, sie hingegen wäre hellwach und mit ihren Gedanken bereits mit gänzlich Anderem befasst gewesen; im Übrigen müsse sie dringend zur Toilette. Auch diese Auskünfte waren Lügen. Die Letztere lieferte ihr immerhin den Vorwand, sich dieser traurigen Peinlichkeit, die bleischwer auf ihnen lastete, zumindest räumlich zu entziehen. Sie kam ohne ihren Pyjama aus dem Badezimmer zurück, nackt bis auf ein Handtuch, das sie über die Schultern gelegt hatte. So trat sie vor den Kleiderschrank um die Kleidung für den Tag auszuwählen. Helm zweifelte nicht daran, dass diese für sie ungewöhnliche Handlung nichts anderes als ein unbeholfener Versuch war, eine unaufgeregte Nähe und freundschaftliche Verbundenheit zwischen ihnen wiederherzustellen. Doch Helm lag immer noch abgewandt von ihr und folgte ihrem Tun nur aus den Augenwinkeln; er verspürte keine Lust, den zu Dank verpflichteten Empfänger ihrer barmherzigen und versöhnlichen Signale abzugeben. Nachdem Isa sich angekleidet hatte, zog sie den Vorhang beiseite. Das Meer lag an diesem Morgen unter einem seltsamen Licht. Weit draussen, an einigen Stellen, wo die Sonne durch die Wolkendecke drang, glänzten einige seiner Partien hell und silberfarben. Anderswo aber schoben sich ungeheuere, schwarz-blaue Wolkenballungen über die Wasser in Richtung Küste. Scharen von Möwen kauerten sich in den steinigen Ebenen unterhalb der beiden Felsplateaus, über deren Ausläufer immer wieder weisse Kaskaden von brechenden Wellen empor stiegen. Über die ganze Länge der Uferlinie zog sich ein brodelnder und wogender Wellengürtel. Das Licht des Himmels wechselte innerhalb von wenigen Minuten zwischen den unterschiedlichsten Schattierungen, die aber allesamt merkwürdig unbestimmt waren, – sie waren keiner Tageszeit zuzuordnen, sondern schienen allein dem aufkommenden Sturm zugehörig. Dann, als gerade blendendes Sonnenlicht verstärkt durch die Wolken drang, ging ein feiner, doch kräftiger Sprühregen, dessen Fallinien durch Windböen zu kuriosen Kurven gebogen wurden, über der Landschaft nieder.
»Heute werden wir wohl eher nicht zum Strand gehen«, murmelte Isa. Helm, immer noch regungslos der Wand zugekehrt, schwieg weiter beharrlich.
Auch das Frühstück, in dessen Verlauf sich die Szenerie jenseits des großen Fensters in einem beängstigenden Maße verdüsterte, verlief schweigsam. Dafür brüllte der Wind draussen um so lauter. Nach der ersten Mahlzeit des Tages waren die beiden Pauschaltouristen in Vollpension etwas ratlos, wie sie die Zeit bis zum Mittagessen füllen sollten. Helm schlug Brettspiele vor, doch Isa war sich nicht sicher, ob das nicht nur eine seiner sarkastischen Bemerkungen war, die zumeist nur er selbst witzig fand. Er war immer noch überaus wortkarg, doch sie glaubte Anzeichen dafür zu erkennen, dass er nach und nach die morgendliche Zurückweisung verwand. Sie setzten sich in eine Sitzlandschaft der Hotellobby, wo sie gelangweilt in internationalen Zeitschriften blätterten, während der Wind unermüdlich an allen beweglichen Teilen der Fassade zerrte. Das Mittagessen, das sie an den zurückliegenden Tagen immer ausgelassen hatten, war überraschend kläglich. Gerade als sie den Speisesaal verlassen wollten, ging ein Platzregen nieder. Erstaunt über die Stärke des Unwetters standen sie vor dem großen Fenster; die Sicht, die es ihnen gewährte, betrug aufgrund der Dichte des Regens nur wenige Meter Tiefe. Sie fühlten sich zunehmend wie eingesperrt in diesem Hotel. Daher war bei beiden die Erleichterung groß, als es am frühen Nachmittag zwar nicht aufklarte, doch immerhin vereinzelt ein wenig Sonnenlicht durch die Wolkendecke drang. Es regnete auch kaum noch, allerdings blies der Wind unvermindert stark. Eilig holten sie warme Kleidung aus ihrem Zimmer, fuhren nach unten und gingen zur Pforte, hinter der sie über einigen dort verstreut liegenden Müll hinweg steigen mussten. Dann liefen sie durch die steinerne Einöde in Richtung Strand. Sie gingen gebeugt, der Wind riss beständig an ihnen, immer wieder wurden ihre Schritte von besonders starken Windstössen verlangsamt; wenn sie mitunter aus dem Schutz der Steine heraustraten, hatten sie gar Mühe, ihren Körper im Gleichgewicht zu halten. Dennoch fühlten sie sich wie befreit: es war gut, hier draussen zu sein, in Wind und Wetter, und die Wirkung der Elemente am Körper zu spüren.

Es überraschte sie wenig, als sie sahen, dass die beiden großen Boote von gestern nicht mehr auf dem Strand lagen. Dort war indessen auch ihres Bleibens nicht, denn kein Hindernis bot sich hier den Böen, und ihre wenigen Worte wurde von dem Getöse der Wellen übertönt. Sie wandten sich also zum Gebirge zu ihrer rechten, doch als Helm, der vorausging, dort angelangt war und ohne Zögern den Anstieg begann (wenn auch weiter hinten, in einem gehörigen Abstand zu den vorderen Felsen, die, dunkel und glänzend vor Nässe, von der wütenden See bedrängt wurden), stellte ihm Isa die möglichen Gefahren eines solchen bei dieser Witterung vor Augen. Er tat überrascht, blinzelte nach oben in Richtung des vor ihm liegenden Weges, zuckte mit den Schultern und meinte, das würde schon gehen, doch sie könne ja gerne zum Hotel zurückkehren. Mit diesen Worten ging er weiter, bedächtig jeden Schritt erwägend. Isa verfolgte das eine Weile aufmerksam, und als Helm schon fast hinter einem Vorsprung verschwunden war, begann auch sie mit dem Aufstieg, sorgfältig seinem Weg folgend. Als sie auf etwa halber Höhe des Massivs angekommen waren, begannen die ersten Tropfen zu fallen. Isa rief hinauf, dass sie umkehren sollten, um sich weiter unten einen überhängenden Felsen zu suchen, der ihnen Schutz bieten würde. Helm schaute kurz auf den Himmel über ihnen und rief ihr dann zu, dass es dafür zu spät sei. Als sie ihn erreicht hatte, gab er ihr zu bedenken, dass die Höhle, die nicht mehr fern sein könne, der sicherste Ort sei. Doch Isa schaute nur zweifelnd auf die vor ihnen liegende Wegstrecke. So standen sie für einige Sekunden unschlüssig, lange genug, um zu fühlen, wie die Feuchtigkeit begann, durch ihre laut Herstellerangaben regendichte Allwetterkleidung zu dringen. Isas Miene wurde zunehmend verzweifelter. Helm fürchtete, es könnten sich jeden Moment auf ihrem Gesicht Tränen mit den Regentropfen vermischen. So nahm er sie bei der Hand und zog sie die ersten Meter weiter hinauf, bis sie sich von ihm frei machte, um sich mit ihren beiden Händen an Steinen und Wurzeln festhalten zu können. Kurze Zeit darauf kamen sie in Sichtweite der abschüssigen Geröllhalde, in deren Mitte sich der Höhleneingang befand. Mehr oder minder auf allen Vieren krochen sie darauf zu, da sie auf den regennassen Steinen immer wieder abrutschten. Als sie die Höhle erreichten, waren ihre Kleider bereits gänzlich durchnässt. Wie schon bei ihrem ersten Besuch fanden sie im Inneren der Höhle Reisig, trockene Blätter, einen Stapel Brennholz, in dessen Nähe nunmehr sogar eine Schachtel Streichhölzer vor. Helm begann unverzüglich damit, ein Feuer anzuzünden. Als die ersten Scheite brannten, entkleideten sie sich und legten die Kleidungsstücke auf Steinen in der Nähe der Feuerstelle aus. Dabei fiel Helms Telefon aus der Jackentasche. Er betastete es besorgt, als ob er dadurch herausfinden könnte, ob es Schaden davongetragen habe; offenbar beunruhigte ihn auch die Nässe, der das Gerät ausgesetzt gewesen war, denn er rieb fortgesetzt mit dem nackten Unterarm darüber. Isa, die sich gerade ihres Büstenhalters entledigt hatte, verhakte dessen Verschluss wieder, hängte das Kleidungsstück an die Gabelung eines Astes, nahm ohne ein Wort dem erstaunten Helm das Telefon ab, legte es in den Büstenhalter hinein und hielt diesen dann an dem Ast in geringem Abstand über die Flammen, dabei verbindlich Helm zulächelnd.
Helm fand das offensichtlich immer noch nicht witzig, was aber wohl kaum der Grund dafür war, dass seine Erzählung an dieser Stelle erneut abbrach. Zweifellos war sie einmal mehr an einer weiteren einschlägigen, neuralgisch-heiklen, da dem Erzähler überaus peinlichen Wegmarke angelangt. Es könnte sich gar um eine ihm sozusagen doppelt peinliche handeln, da sich zu ihrer Wesensart des Geschlechtlichen auch noch eine gewisse Albernheit beigesellt zu haben schien – eine Verbindung, die zwar nicht gerade selten zu sein scheint, doch in der Regel als unpassend, ja sogar als geradezu unwürdig empfunden wird. Wie auch immer: anstatt mit dem Bericht dessen fortzufahren, was sich in der Folge in jener Höhle zugetragen hatte, hielt Helm nunmehr Ausschau nach seinem vor geraumer Zeit schon bestellten Bier, fixierte sodann irgendeinen Punkt auf der Tischplatte vor ihm, tat dann wiederum so, als besinne er sich, ob er nicht ein bestimmtes Gesicht aus der Gästeschar nicht von irgendwoher kenne. Kurz: er betrug sich kindisch. Seinem Zuhörer waren solche dem Fortgang der Erzählung wenig dienliche Manöver leider nicht mehr neu – bereits das, was sich am Morgen selbigen Tages zwischen den beiden Protagonisten in ihrem Hotelbett zugetragen hatte, musste er aus rudimentären, eher unwillig gegebenen Auskünften seines Freundes herauslesen. Er hatte sich dabei gefühlt, wie ein Paläontologe sich in etwa fühlen könnte, der anhand eines Hüftknochens die Gestalt eines ganzen, längst ausgestorbenen Tieres entwerfen muss. Doch diesen einen Knochen immerhin benötigte Winkler, und dieses Mal musste er ihn dem Cellobauer förmlich abringen. Endlich murmelte Helm, wobei er angestrengt in sein neues, doch bereits gänzlich schaumfrei bei ihm angekommenes Glas Bier starrte: »Ja, damals in dieser Höhle, an dem Feuer , da wollte Frau von Ramsperg auf einmal dann doch … «.
Nun gut. Was aber sollte ein gewissenhafter Chronist nun mit dieser dürren, allgemein gehaltenen Auskunft anfangen? – In solchen Fällen ist selbst der Autor eines Tatsachenberichtes ganz auf sich, auf seine sensorische Phantasie, auf seinen Spürsinn für das Wahrscheinliche und Naheliegende zurückgeworfen. Offensichtlich schien Winkler zunächst einmal, dass dieselbe schwer ergründbare Energie, dieselbe Begierde, die durch das Abgeschmackte und Peinliche ihrer Erscheinungsform den Tagesbeginn jener zwei Personen so verfinstert hatte, erneut am Wirken war, dieses Mal aber ganz ins Leichte und Spielerische gewandt, woraufhin sie wundersamerweiswe auf der Stelle triumphierte. Wie aber mochte das zugegangen sein? Nun darf man Isaura von Ramsperg wohl nicht nur eine Gefühlsmenschen oft zueignende Offenheit des Herzens zuschreiben, sondern ihr auch eine gewissen Pragmatik in sexuellen Angelegenheiten unterstellen, denn diese beiden Eigenschaften treffen erwiesenermaßen häufig in einer Person zusammen. Es wäre also möglich gewesen, dass es über einem neckisch-kindlichen Gebalge um das preziöse Mobiltelefon unversehens zu Handlungen sexueller Natur gekommen wäre. Doch das wäre ein zu banales Stereotyp, so banal schon, das es sich schwerlich in eine so wenig banale, freilich auch wenig plausible Geschichte, wie wie diese eingliedern liesse. Eher schon könnte man vermuten, dass …

… der unbekleidete Helm in der Höhle nach einem kurzen, doch energischen Einspruch das ihm teuere Kommunikationsgerät zurückerlangt und sich mit ihm auf einen Stein in der Nähe des Feuers zurückgezogen hatte. In der Folge war er allerdings seiner Begleiterin durch seine fortgesetzten Bemühungen auffällig geworden, in einer möglichst unauffälligen Weise unnatürliche Körperhalt- ungen einzunehmen; beispielsweise schlug er die Beine übereinander und lehnte den Oberkörper dabei weit nach vorne, was ausgesprochen unbequem sein musste. Schliesslich brachte er das Telefon gar in einem überaus merkwürdigen, ihr fast schon exotisch anmutenden Winkel vor seinem Schoß in Anschlag, und tat dabei so, als würde er seine E-Mails abrufen. Von draussen drang das Prasseln des Regens gedämpft herein, manchmal knackte im Feuer einer der rot glühenden Scheite. Da geschah etwas Unerwartetes und Unwillkommenes für Helm: Isa, die in all den zurückliegenden Tagen niemals auch nur das geringste Interesse diesbezüglich geäussert hatte, begehrte mit einem Mal eine »kleine Einführung« bezüglich Funktionsweise und Handhabung dieses zweifellos auf dem neuesten Entwicklungsstand befindlichen Kommunikationsgerätes zu bekommen. Als sie diesen Wunsch äusserte, befand sie sichauch schon ganz nah neben Helm. Wiederum nahm sie ihm das Telefon umstandslos aus den Händen, doch nur, um dann stumm an ihm herab zu sehen und einen ebenso leisen wie heuchlerischen Laut der Überraschung zu äussern. Das Gerät legte sie immerhin noch sorgsam auf den felsigen Boden, bevor sie ihn behutsam an der Extremität, der jener Laut gegolten hatte, zu sich heranzog. In einer gemischten Gefühlslage aus Amusement und Erregung horchte sie in der Folge eine kleine Weile auf einige leise, ihr wie tierhaft erscheinenden Laute, die ihrer beider Blut im Allgemeinen und ihre Körpersekrete im Besonderen dort unten im Zentrum ihrer Körper verursachten. Als sie dann fand, es wäre an der Zeit, auf einer anderen Ebene fortzufahren, brauchte sie weiter nichts zu tun, als ihre linke Hand, die sie bisher gegen Helms Becken gepresst hatte, um den ihr entgegen Drängenden auf der bis dahin für ihre Absichten richtigen Distanz zu halten, einfach von dort wegzunehmen. –
Als die beiden die Höhle in fast trockener Kleidung verliessen, hatte sich der Himmel aufgehellt; weit draussen fielen fast konzentrisch angeordnete Bahnen von Sonnenlicht lanzenförmig durch die Wolkendecke und malten Lichtkreise auf den noch immer düster-bewegten Wassern. Tief unter ihnen brachen sich die Wellen mit unveränderter Heftigkeit an den Felswänden. Während die beiden Ausflügler jenseits des Gipfelgrates wieder in leichter gangbares Gelände hinabstiegen, erzählte Isaura von amerikanischen Schauspielerinnen, die – obgleich bereits jenseits der fünfzig – noch schwanger geworden waren und zuzeiten ohne Komplikationen gesunde Kinder entbunden hatten. Sie hatte über diese Phänomene in einer Zeitschrift gelesen. Helm gab zu bedenken, dass diese überspäten Geburten seinem Dafürhalten nach auf einschlägige hormonelle Behandlungen zurückzuführen wären… Helm und Isaura von Ramsperg waren in diesen Minuten wieder wie Zwanzigjährige, die unsicher in ihr zukünftiges Leben wie in einen fremden, wildwüchsigen Wald hineinriefen, um anschliessend auf Antworten zu lauschen, die sie natürlich nicht erhielten.
Unten, in der Ebene, jagte der Wind unverdrossen durch die Gassen zwischen den steinernen Gebilden, trieb vollständige entwurzelte Büsche, leere Plastiktüten und auch einige Gegenstände, die sie so rasch nicht zu bestimmen vermochten, vor sich her. Erst am Hotelquader brach er sich und rüttelte dort – als wäre er ausser sich geraten über dieses Hindernis, das es wagte, sich in seinen Weg zu stellen – an Türen und Fenstern. Die beiden Touristen waren recht froh, als sie die Stahltüre, um die herum die Klappen der Mülltonnen gegen die Mauer dahinter schlugen, passiert hatten und im Inneren des Gebäudes einen gewundenen Korridor entlang gingen. An dessen Ende gelangten sie an die ihnen bereits vertraute Treppe, die sie nach oben in das Foyer und den daneben liegenden Speisesaal führen würde. In Letzterem saßen sie kurz darauf, an ihrem gewohnten Tisch in Nähe des Fensters. Die schweren Vorhänge am Panoramafenster des Speisesaales waren an diesem Abend geöffnet, und so sahen sie ihre Spiegelbilder, sowie die der anderen Gäste und Bediensteten darin. Auf dieser Fläche mischten sie sich mit dem vom Licht des Vollmondes beleuchteten, kargen Terrain draussen, durch dessen schwärzliche Steinhäufungen der Wind immer noch Gewächse und Müll trieb.
Nach dem Abendessen zeigte Isa wenig Lust, ihr windumtostes Zimmer im elften Stockwerk aufzusuchen. So setzten sie sich auf zwei Hocker der Hotelbar, in der sie nach kurzer Zeit schon die einzigen Gäste waren. Helm trank jene Spirituose, die er schon am ersten Abend bestellt hatte, während Isa sporadisch ein Glas mit Rotwein an die Lippen führte. Sie sprachen nicht mehr viel an diesem letzten Abend; Helm hütete sich davor, Grundsätzliches ihre Zukunft betreffend anzusprechen, war dafür in Gedanken aber umso mehr mit dem möglichen, wahrscheinlichen oder wünschenswerten Fortgang seines Lebens beschäftigt. Isas Aufmerksamkeit hingegen schien gänzlich von dem Sturm und seinen Geräuschen in Anspruch genommen. Diese fand sie nach wie vor beängstigend, doch inzwischen »irgendwie auch schön«. Einmal, als ihr Schweigen wohl besonders lange gewährt hatte, trat unvermittelt der schwarz befrackte Barkeeper an sie heran, streckte den Oberkörper vertraulich über den Tresen und verkündete: »Wind will be gone soon. All will be quiet. Tonight: everything will be quiet.« Isa lächelte, konnte indessen nur schlecht ihre Indignation über die unvermittelte Annäherung des Mannes verbergen, während Helm ihm verbindlich, aber zerstreut zunickte und nur ein ebenso rhetorisches, wie nichtssagendes »Oh, really?« zurückgab.
Als sie auf ihrem Zimmer angelangt waren, hatte der Wind in der Tat bereits abgeschwächt. Isa war es, als ob der Sturm über das Hotel hinweg und landeinwärts gezogen wäre; sein Heulen aber schien ihr wie das stetig schwächer werdende Geräusch eines sich entfernenden Zuges. Später kam sie in ihrem übergroßen Pyjama aus dem Badezimmer, legte sich auf ihre Seite des Bettes neben Helm, der sich ein letztes Mal für diesen Tag einen Überblick über seinen elektronischen Posteingang und die globale Nachrichtenlage verschaffte. Dabei fiel ihr zum ersten Mal auf, dass Helm in den zurückliegenden Tagen kein einziges Telefonat empfangen, noch er selbst jemanden angerufen hatte. Jetzt scrollte er emsig in einer Nachrichten-Website. Die Hauptmeldungen des Tages bezogen sich auf die fortwährenden Unruhen in einem nahöstlichen Land, die sich zur Stunde offenbar zu einem wieder einmal reichlich archaischen Bürgerkrieg auswuchsen. Ferner war es in den Stammesgebieten der kanadischen Ureinwohner wegen des Abbaus der dortigen Ölschiefer- vorkommen zu Protesten gekommen, wobei auch Förderanlagen zerstört wurden. Die Regierung und das Förderkonsortium erwogen nunmehr eine Umsiedlung und die Abfindung der Indianer … – Das sei ein richtiger Sturm gewesen, vermeldete Helm, als er dann, viel weiter unten, fündig geworden war: in jener nahegelegenen Landesmetropole, von deren Flughafen aus sie am morgigen Tag den Rückflug antreten würden, wären sogar einige Gebäude eingestürzt. »Oh«, sagte Isa daraufhin mit der ihr in diesen Situationen eigenen, ebenso ungekünstelten wie formelhaften Betroffenheit. Und nach einer Pause stellte sie kurz, unvermittelt und sehr kategorisch klar, dass sie in dieser Nacht nicht mit ihm schlafen werde. »Schon gut«, sagte Helm, während er den Bericht über das Unwetter las, das ihr Gastland heimgesucht hatte. Wieder schwiegen sie, dann hielt es Isa für angebracht, zur Bekräftigung des Gesagten mit leiser, doch drohender Stimme hinzuzufügen: »Bleib‘ mir bloß vom Leibe!«. Helm, der »Schon gut« bereits eben gesagt hatte, verlegte sich nun auf ein in seiner Knappheit fast militärisch anmutendes: »O.K., geht in Ordnung!«.
Das schien sie zu überzeugen und so löschte sie denn das Licht, drehte sich auf die Helm abgewandte Seite und wünschte ihm, dessen Gesicht nun inmitten der Dunkelheit in dem schwachen Widerschein des Displays lag, eine gute Nacht.
Nach Betätigung der Klospülung drang auch in dieser, ihrer letzten Nacht in jenem an der Küste von N. gelegenen Hotel ein leises, wie wehmütiges Wimmern aus der Tiefe des Fallrohres. Helm lauschte dem rätselhaften Geräusch nach, und erst als es verklungen war, fiel ihm auf, dass der Wind sich, während sie geschlafen hatten, vollends gelegt haben musste, da andernfalls dieser vertraute Klagelaut aus dem Inneren der Kanalisation nicht vernehmbar gewesen wäre. Beim Hinausgehen aus dem nur von Mondlicht erhellten Badezimmer fiel ihm noch etwas auf: der grüne Plastikfrosch leuchtete nicht mehr. Er nahm ihn in seine Hände, drückte ihn auf verschiedene Weisen, diesmal in der Absicht und dem Bemühen, ihn wieder zum Leuchten zu bringen. Es war umsonst: kein Lichtstrahl drang mehr aus seinem Inneren. Er stellte ihn auf seinen Platz zurück und verliess das Bad. Auf seinem Weg zum Fenster stolperte er über einen Gegenstand, und in dieser Nacht musste er sich nicht mehr danach bücken, um zu wissen, worum es sich dabei handelte. Mit einer gelinden Verbitterung konstatierte er, dass Isa an diesem Abend nicht einmal mehr in dem Buch gelesen hatte, sie es also vor dem Einschlafen rein gewohnheitsmäßig auf den Boden vor ihrem Bett geworfen haben musste. Diesen Gedanken vergaß er aber sofort wieder, als er an das Fenster getreten war und den Vorhang zur Seite geschoben hatte. Der Himmel war sternenklar, nur ab und an eilten vereinzelte, filigrane Wolkenfahnen über das Meer in Richtung Land. Sie erschienen ihm wie die zersprengten Glieder eines geschlagenen, aufgeriebenen Heeres. Der Mond stand groß und tief über den silberfarbenen Wassern, die ihrerseits zu schlafen oder zumindest sich von dem ermüdend stürmischen Tag auszuruhen schienen. Die Steingebilde in der weiten Ebene wirkten so, als hätte jemand einige Mühe darauf verwendet, sie mitsamt ihrer langen Schatten akkurat auszuschneiden. Einem plötzlichen Gedanken folgend, hob er den Blick nach oben und da begann auch sein Herz beträchtlich höher, irgendwo knapp unterhalb des Kehlkopfes zu schlagen. Schwarze Schatten spannten sich über dem Dach des Hotels. Es war eine noch größere Zahl als in der vorvergangenen Nacht. Lautlos durchschnitten die Vögel den Himmel; spielerisch umkreisten sie dabei einander, ohne sich je zu nahe zu kommen. Lange schaute Helm hinauf, dann kam ihm Isa in den Sinn und der Wunsch, sie möge das sehen. Gerade als er an das Bett treten wollte, um sie behutsam zu wecken, gewahrte er aus dem Augenwinkel eine Bewegung in der steinernen Einöde vor dem Strand. Er hielt inne und spähte nach unten, glaubte bereits, sich getäuscht zu haben, erwog eine nervliche Überspanntheit seinerseits als Ursache dafür. Doch plötzlich löste sich aus dem Schatten eines jener biomorphen Steingebilde eine gedrungene Form. Zwei weitere folgten. In loser Formation durchstreiften sie das Gelände. Von der Art, wie sie die Köpfe zu Boden neigten, um Witterung aufzunehmen, schloss er auf Hunde. Nach und nach entdeckte er noch mehr von diesen Tieren, zwei gar in unmittelbarer Nähe der mülltonnengesäumten Pforte, andere, in weiterer Entfernung, trotteten dem Strand entgegen. Es mochte insgesamt ein Dutzend sein, doch Helm hatte nicht den Eindruck, dass es sich dabei um ein Rudel handelte. Ihm fiel auf, dass die Tiere merkwürdig schleppend, fast schleichend gingen, was er nicht mit der ihm bekannten Gangart von Hunden in Einklang bringen konnte. »Sind das etwa Wölfe?« fragte er sich deshalb. Er schrak zusammen als er eine ebenfalls leise, leicht bebende Stimme hinter sich hörte. »Das sind keine Wölfe«, sagte die Stimme, »das sind Hunde, große Hunde.« »Wilde Hunde? Was machen die dort unten?« – Helm war durchaus erleichtert, nun jemanden zu haben, dem er diese Fragen stellen konnte. Doch statt einer Antwort hörte er hinter sich das Geräusch einer sich öffnenden Schublade und kurz darauf trat Isa neben ihn ans Fenster, ihren Feldstecher vor Augen. Zwischen zwei Felsen wurde gerade einer der Vierbeiner von drei seiner Artgenossen umstellt. Für Augenblicke stand die Gruppe unbeweglich im Mondlicht, doch dann bedrängten die drei Angreifer gleichzeitig den Einzelnen, der zurückwich und nach einigen wenig überzeugenden Drohgebärden floh. Doch selbst noch in der Fluchtbewegung hatte das Tier jenen schleppenden Gang unter einem durchgedrückten, seltsam herabhängenden Hinterkörper, der aussah, als könnte er jeden Moment vom Rest des Körpers in einem senkrechten Winkel abknicken. »Was ist los mit denen?« murmelte Helm und bemerkte dabei beiläufig die Undifferenziertheit seiner Frage. Um so überraschter war er über die Präzision von Isas Antwort. »Degenerative Myelopathie«, diagnostierte sie knapp. Er schaute stumm zu ihr hinüber, sie hatte das Fernglas immer noch vor Augen. »Schon mal was von der sogenannten ›Schäferhundekrankheit‹ gehört?«. Da er immer noch nichts sagte, antwortete sie sich selbst: »Ach nein, hast du sicherlich nicht … So bezeichnet man eine Krankheit, die seit einiger Zeit bei älteren Tieren größerer Hunderassen auftritt: das Rückenmark, die Nerven funktionieren dann nicht mehr und daraufhin kriegen sie die Hinterpfoten nicht mehr hoch, laufen sozusagen nur noch auf den Zehenspitzen. Schliesslich setzt irgendwann die Lähmung ein. Schreckliche Sache.« Nachdem sie ihren Kopf mitsamt dem Fernglas davor etwas gedreht hatte, fuhr sie fort: »Einige von denen scheinen allerdings auch unter einer Hüftdysplasie zu leiden. Das ist so etwa das gleiche in Grün, glaube ich, eine Fehlbildung der Gelenke der Hinterläufe, die zu diesem schlingernden Gang führt …« »Was machen die hier?« insistierte Helm, Isa unterbrechend. Er klang störrisch wie ein Kind, das nicht wahrhaben will, was es vor sich sieht. Sie zuckte nur kurz mit den Schultern: »Unheilbare Autoimmunkrankheiten sind das; zu Ende des zwanzigsten Jahrhunderts traten sie plötzlich auf, und dann auch gleich massenhaft, epidemisch. Werden durch Vererbung weitergegeben: Züchtungen, nicht wahr … Vielleicht hatten die dort unten einfach keine Lust, sich einschläfern zu lassen, so wie all die anderen vor ihnen … und nun sind sie eben hier.« Diese letzten Worte sprach sie wie abwesend aus. Helm sah, dass sie das Fernrohr nicht mehr auf die Szenerie an Land gerichtet hielt, sondern hinaus auf die Dünung. Er fand, sie würde besser ihm das Instrument geben, er würde einen sinnvolleren Gebrauch davon machen. Doch er sagte das nicht, sondern schwieg und wartete angespannt. Sie machte indessen keinerlei Anstalten, das Glas abzusetzen. Immerhin rückte sie endlich mit der Sprache heraus: Sie wisse zwar bei »Gott nicht«, sagte sie, um was es sich dabei nun handeln könnte, doch fest stünde für sie, dass das sehr große Lebewesen sein müssten, die sich dort bewegten … – »Was?« raunzte er daraufhin enerviert: »Was bewegt sich wo?« – … und da es sich dabei um große, sich unter Wasser bewegende Körper handele, fuhr Isa fort und schien weiterhin nur zu sich selbst zu sprechen, müsse man wohl annehmen, dass sich dort, im seichten Küstenwasser, ungeheuerlich große Fische aufhielten. Nun hielt es Helm nicht mehr. Wortlos griff er nach dem optischen Gerät und sie gab es aus ihren Händen. Jetzt sah auch er die Bewegungen auf der mondbeschienen Wasseroberfläche, die hier und da in Ufernähe ein leichtes Heben und Senken auf einer ansonsten auffallend flachen See hervorriefen. »Sind das etwa Haie? Oder Wale? … Könnten diese Wirbel nicht auch von irgendwelchen Strömungen verursacht werden?« fragte er Isa, gerade so, als ob sie ihm eine verbindliche Auskunft darüber geben könnte. »Haie …Wale … An dieser Küste?« sie schüttelte nur den Kopf und legte dann die Stirn an die kalte Scheibe.
In der Folge standen sie lange Zeit Seite an Seite, reichten einander das Fernglas und sprachen kaum – am Fenster jenes Zimmers des Futura Beach Grand Hotel*** , das sie nach dieser Nacht räumen würden und das sie dann während sechs Tagen und sechs Nächten ihres Lebens bewohnt haben würden. Sie schauten auf die nächtliche Landschaft und die sie zu Wasser und zu Lande durchstreifenden Wesen. Manchmal fragten sie sich nach Dingen, die sie sich nicht beantworten konnten. Das wussten sie schon vorher, doch sie fragten trotzdem. Dann schwiegen sie wieder, möglicherweise, weil sie die ständigen Mutmaßungen, mit denen sie sich behelfen mussten, etwas ermüdeten. Am Ende rückte Isa die beiden Sessel vor das Fenster. Sie verursachte dabei eine Menge Lärm, den aber niemand ausser ihnen hörte. Fortan saßen sie nebeneinander, Helm vorgebeugt und den Feldstecher im Anschlag; Isa dagegen wurde zusehends schläfriger, langte auch bald schon nach hinten und zog die Bettdecke herbei, die sie über sich und Helm warf, der sie jedoch umgehend abschüttelte. Wenig später hörte er den regelmäßigen Atem der Schlafenden an seiner Seite, fühlte ihren Kopf an seiner Schulter, spürte die Wärme ihres Körpers. Zwar fuhr er damit fort, den nächtlichen Strand und die Dünung zu beobachten, doch war es ihm merkwürdigerweise bereits fast gleichgültig, um was genau es sich bei diesen Phänomenen handelte. Er dachte über die zurückliegende Woche nach: einen Zeitabschnitt voller Geschehnisse, von denen er den Eindruck hatte, sie wären zwei anderen Menschen widerfahren. Bereits jetzt schienen diese Begebenheiten weit zurück in der Vergangenheit zu liegen und den Grund dafür vermutete er in jenem Spiel, das er und Isaura von Ramsperg wie auf eine stumme Übereinkunft hin gespielt hatten und dessen Ziel wohl war, die Vergangenheit zugunsten der Illusion einer Zukunft zu ignorieren, die ihnen zwar nicht zu freier Verfügung stehen würde, ihnen aber doch noch eine Vielzahl von Optionen böte. Dabei wussten sie im Grunde ganz gut, dass die Chance die sich ihnen aufgetan hatte, die Gelegenheit, die sich für sie geboten hatte, im Gegenteil in einer schon fernen, naturgemäß unwiederbringlichen Vergangenheit lag. Sie hatten sie nicht wahrgenommen, sie hatten sie vorüberstreichen lassen, tatenlos hatten sie zugesehen, wie der Vorhang sich wieder vor ihnen geschlossen hatte. Das Leben hatte sie damals vor eine Wahl gestellt und wie Helm jetzt schien, waren sie vor zwei einander sich ausschliessende Möglichkeiten gestellt worden. Sie hatten sich schliesslich für das geruhsame Leben entschieden. Helm für seinen Teil hatte sich nicht allein nur für ein ruhiges, konzentriertes, sondern sogar auch noch für ein annähernd egozentrisches Leben entschieden: sein Streben war damals eben nach einem möglichst dauerhaften Zustand einer möglichst gefühlsarmen Erfüllung gegangen. – Dies alles sah er in diesen Augenblicken klar vor sich und dennoch konnte er sich nicht dazu durchringen, in der Rückschau seine und Isas damalige Entscheidung für falsch zu halten. Hingegen mochte er ebenso wenig dieses seit fast sieben Tagen andauernde Spiel, das jetzt als beendet gelten konnte, verurteilen: es mochte naiv, vermessen, auch kindisch gewesen sein, doch er hielt es nach wie vor für richtig, sich darauf eingelassen zu haben, einfach, weil es seinem Dafürhalten nach nichts Endgültiges im Leben gab, diese Kategorie allenfalls dem Tod vorbehalten war. Darauf immerhin war Verlass, und das war kein kleiner Trost, wie er fand. Im Übrigen schien ihm das Leben der Menschen an und für sich schon nicht besonders geradlinig zu verlaufen; manchmal jedoch konnte es geradezu die aberwitzigsten Haken schlagen und dabei Figuren von abenteuerlicher, fremdartiger Schönheit erschaffen, – kaskadenartige Gebilde aus sogenannten Zufällen, die von kristalliner Beschaffenheit und kunstvoll miteinander verschlungen waren und vor denen der Betrachter dann wie verzaubert stand, in vollem Bewusstsein dessen, dass diese Gebilde auf einen Bauplan zurückgingen, den er niemals durchschauen würde.
So hatten sie also während der zurückliegenden Tage versucht, diesem Leben auf die Sprünge zu helfen; sie hatten es unternommen, mit ihren bescheidenen Mitteln und geringen Kenntnissen diese rätselhafte Maschine in Gang zu setzen. Das war möglicherweise auf eine etwas mutwillige Weise geschehen, doch war es die einzige gewesen, die ihnen zur Verfügung gestanden hatte. Während der Dauer dieses Versuches musste ihnen Zeit und Gegenwart wie arretiert erscheinen, auch das empfand Helm nunmehr als folgerichtig. Von nun aber würden diese wieder ihre gewohnt dominanten Rollen einnehmen und man würde sehen, wohin man von ihnen geführt werden würde. Sie hatten immerhin getan, was sie hatten tun können.
Helm dachte auch an Kinder, und dass er wieder beginnen wollte, sie anzusehen, auf sie zu achten, vielleicht sogar, mit ihnen zu reden, obwohl er wahrscheinlich immer noch der Meinung sein würde, er und Kinder hätten nichts miteinander zu schaffen; er war sich jedoch in jener Nacht eigentümlich sicher, dass Kinder selbst nie auf einen solchen Gedanken kommen würden.
Helm saß noch Stunden, beobachtete und dachte. Das Letzte, was er einigermaßen mit Bewusstheit sah, war der erste kleine, doch seine müden Augen bereits blendende Bogen der gelblich-dunstigen Scheibe, die begann, über der Meereslinie aufzusteigen, wobei die nun wieder unbelebt und still liegende Küstenlandschaft in die ersten frühmorgendlichen Strahlen getaucht wurde.

VII.
Am Morgen des siebten Tages erwachten Christoph Helm und Isaura von Ramsperg gerade noch rechtzeitig, um ihre Koffer zu packen und zur Abfahrtsstelle des hoteleigenen Shuttle-Busses zu eilen, der sie zum Flughafen brachte. Das Frühstück allerdings entfiel für sie an diesem letzten Morgen im Futura Beach Grand Hotel*** .
Als Helm seine Geschichte beendet hatte, hantierte das Personal bereits seit einiger Zeit betont geräuschvoll in jener Kneipe für Berliner Szene-Touristen. Die inzwischen angezündeten Deckenlampen tauchten den Raum in ein grelles, kaltes Licht. Ringsumher wurden Stühle herumgedreht und auf Tische gestellt, die letzten mehr oder weniger leeren Gläser wurden von den Tischen geräumt, mit feuchten Lappen wurde über klebrige Tischplatten gewischt. Winkler hatte etwas über fünfzig Euro für die im Laufe des Abends von ihnen konsumierten Getränke zu entrichten. Die Höhe des Betrages verwunderte ihn, umso mehr in Anbetracht der Behäbigkeit, mit der die Bestellungen entgegen genommen und die Getränke serviert worden waren. Er beschloss aber, auf eine eingehendere Überprüfung der blassen Zahlenkolonnen auf dem Rechnungszettel zu verzichten. Auch unterliess er es tunlichst, das abgespannte und daher übellaunige Bedienpersonal um das Ausstellen einer Spesenquittung zu ersuchen.
Draussen war es kalt und ungemütlich. Es fuhren um diese Zeit fast nur noch Taxis durch Berlin-Mitte. Nach einigen vergeblichen Versuchen gelang es Helm, eines davon zum Anhalten zu bewegen. Während der Fahrer aus dem geöffneten Seitenfenster periodisch das unbeantwortet bleibende Fragewort »Wohin?« in die Nacht bellte, verabschiedeten sich Helm und Winkler mit einem langen Händedruck und dem gegenseitigen Versprechen, nicht abermals zehn Jahre verstreichen zu lassen, bevor man sich wiedersehen werde. Beide spürten deutlich, dass es aber ungeachtet dieser Versicherung genau so kommen könnte.
Bei ihrer nächsten Begegnung stünden sie dann am Beginn ihres siebten Lebensjahrzehnts.
Lissabon und Frankfurt am Main / Herbst – Winter 2011.

Rupp fliegt.
aus „Fahrende Hunde“ (Darling Publications, 2010)
Während der letzten beiden Jahre des 20. Jahrhunderts war ein heimatloser Deutscher unter den Angestellten von Fluglinien, sowie in Hotels, Reisebüros und Gastronomiebetrieben von Flughäfen als »der fliegende Herr Rupp« bekannt.
Der Mann war zu jener Zeit etwas über fünfzig Jahre alt. Er hatte vorher ein kleines Vermögen in der Werbebranche verdient, insbesondere mit jenem zu diesem Zeitpunkt bereits legendären Slogan für eine Möbelhauskette, der da lautete: Möbel Heyl – so günstig und geil!
Mit dieser Werbekampagne hatte der Inhaber des Unternehmens erfolgreich versucht, eine neue, junge Käuferschaft anzuwerben, für die ein sogenanntes Young Line-Möbelsegment entwickelt worden war: das waren preiswerte Regal- und Schranksortimente, welche nach dem Zusammenbruch der sozialistischen osteuropäischen Regime zunächst kostengünstig in Polen produziert worden waren. Als die dortigen Behörden die Verwendung von Formaldehyd zur Herstellung von Spanplatten verboten, erwarb Heyl ein Werk in Rumänien zur Weiterführung der Produktion. Als sich auch dort chronische Erkrankungen der Arbeiter auffällig häuften und deshalb Untersuchungen eingeleitet wurden, verlagerte Möbel Heyl zügig die Fertigung der Young Line-Möbel zügig nach Kasachstan.
Durch diese geschickte Erweiterung der Produktpalette, dem eingängigen Werbespruch, einem von kommerziellen Radiostationen zu jeder vollen Stunde gesendeten Jingle und vor allem einem – ebenfalls von Rupp konzipierten – TV-Werbespot mit dem bekannten ehemaligen Erotikstar Holly Jumper in der Rolle einer etwas tollpatschigen doch einnehmenden Möbel-Fachverkäuferin, stieg das vordem mittlere Unternehmen mit einem etwas drögen Sortiment zügig zum nationalen Marktführer mit Kultcharakter auf, der schon bald in der Lage war, auch andere europäische Märkte ins Visier zu nehmen.
Nun hatte es aber der Unternehmer – wohl aufgrund einer ererbten kaufmännischen Sparsamkeit – unterlassen, rechtzeitig vor Anlauf der Erstkampagne die Anschlussverwertungsrechte zu erwerben, und danach ging Rupp nicht mehr auf die eiligen Offerten von Möbel-Heyls Anwalt ein, sondern zog es vor, Heyl fürderhin zu melken wie die sprichwörtliche mittelständige Wollmilchsau. Der wollte sich dieser »unverschämten Erpressung« nach einer Weile nicht mehr beugen und beauftragte schließlich eine andere Werbeagentur mit der Ausarbeitung einer neuen Kampagne. Nach einer längeren Vorbereitungs- und Testphase lief der neue Werbefeldzug an. Nun lautete der Slogan fast ebenso kurz und präzise: Möbel Heyl möbelt auch DICH auf! und die Rolle des freundlichen, doch bestimmten Möbel-Fachverkäufers in dem neuen TV-Spot übernahm ein ehemaliger Weltmeister im Halbschwergewichtsboxen, der vor kurzem wieder zu einiger medialer Präsenz gelangt war, weil er unter dem Vorwurf einer versuchten Vergewaltigung an einer Auswahl-Turnerin vor Gericht gestanden hatte.
Der Absatz ging dennoch umgehend rapide zurück. Heyl konnte von seinem Büro aus förmlich dabei zusehen, wie die Kurve der Verkaufszahlen in den Keller ging. Also musste das Unternehmen notgedrungen, um des Umsatzes und natürlich auch der Hunderte von Arbeitsplätze willen, wieder auf Möbel Heyl – so günstig und geil! zurückkommen.
Rupp brauchte sich um seine finanzielle Zukunft nun endgültig keine Gedanken mehr zu machen, er beauftragte lediglich einen Anwalt, der künftig für die Wahrung seiner Rechte Sorge trug. Die Kampagne lief daraufhin über etliche Jahre mit gleichbleibendem Erfolg und unter der stetigen Mitwirkung von Frau Jumper, was vor allem durch gelegentliche Eingriffe der fähigsten plastischen und kosmetischen Chirurgen Europas und Kaliforniens ermöglicht wurde.
Doch da hatte Rupp längst schon seine kleine Eigentumswohnung in Heilbronn für immer verlassen …
Das war problemlos vonstatten gegangen: eines Tages packte er ohne ersichtlichen Grund oder Anlass einen kleinen Rollkoffer und verließ die Wohnung, nachdem er vorher noch gewissenhaft den Kühlschrank ausgeräumt und abgetaut hatte. Er stieg in einen Nahverkehrszug zum Stuttgarter Hauptbahnhof und nahm dort eine S-Bahn, die ihn zum Flughafen Stuttgart brachte, wo er in einem TUI Last Minute-Reisebüro ein Flugticket nach Thessaloniki kaufte.
In Thessaloniki regnete es, deshalb nahm er die nächste Inlandsverbindung nach Athen.
Dort hatte die Maschine eine schwierige Landung, einige Passagiere mussten sich übergeben, was Rupp zwar nicht sah, doch deutlich hörte. Zwei orthodoxe Priester in seiner Nähe murmelten dumpfe Gebete, eine Frauenstimme zeterte hinten im Heckbereich. Es klang für ihn fremd und entfernt wie eine Klage aus einer griechischen Tragödie. Das Flugzeug trudelte lange zwischen den für die Augen der bedrohten Passagieren undurchdringlichen Wolkenschichten hindurch, tauchte endlich darunter hervor, um kurz darauf nach einem letzten Schlingern mit großem Krachen und Getöse aufzusetzen und quälend lange noch über die Landebahn zu glitschen.
Später stand Rupp hinter einem hohen Fenster, an dessen Außenseite Hunderte von dicken Tropfen nach unten perlten, und schaute zu, wie die Flughafengebäude sich unter den Windböen und Wasserkaskaden duckte und zusammenkauerte. Er dachte darüber nach, ob er nach dem Sturm den Flughafen verlassen und in Piräus ein Schiff nach der Ägäis besteigen sollte. Er hätte sich auf irgendeiner Insel ein halbverfallenes Haus kaufen und es von einheimischen Handwerkern instand setzen lassen können. Was aber dann – was wäre darauf geschehen? Nun, dann hätte er beispielsweise fischen können. Doch er hatte noch nie geangelt. Möglicherweise würde es ihn langweilen, wenn er es nicht gar verabscheuen würde, was er nicht ausschloss. Womöglich gab es auch gar keine Fische mehr in den dortigen Gewässern. Er kannte im Übrigen die Ägäis überhaupt nicht, vielleicht würde sie ihm nicht einmal gefallen, man konnte auch das nicht wissen. Vielleicht würde er dann nur von Insel zu Insel fahren, fluchend, pöbelnd, trinkend, und zügig zu einem verwahrlosten Säufer werden.
Dennoch versuchte er, sich einen Ruck zu geben und endlich aus dem Flughafengebäude aufzubrechen. Er schaute sich um, ob er etwa ein Hinweisschild zu einem Busbahnhof finden würde. Der Regen aber ging weiter.
Einige Stunden später stand er am Schalter der Air France und buchte einen Flug nach São Paulo. Es regnete noch immer, wenn auch schon etwas schwächer.
Er könnte sich auch irgendwo in Brasilien ein Haus kaufen, sagte er sich. Außerdem war es sicher einfacher, dort eine Frau zu finden, als auf irgendeiner ägäischen Insel mit womöglich verknöcherten, noch halb-archaischen Sitten. Dennoch empfand er es wie eine Niederlage, als er Stunden später die Air-France–Maschine bestieg.
Der Sturm hatte sich inzwischen ganz gelegt, das Flugzeug hob sich über einigen geknickten Zypressen in den Himmel.
Er kam an einem sehr frühen Morgen auf dem Aeroporto Guarulhos in São Paulo an. Nach einem Spaziergang im Passagierbereich des Flughafens versuchte er, sich an einem Geldautomaten mit Reais zu versorgen, was ihm nicht gelang. Schließlich fand er eine Wechselstube, wo er einen Scheck einlöste. Nach einem bescheidenen Frühstück setzte er sich auf einen Stuhl und hörte sich Teile des Konzertes eines Jugendsinfonie-Orchesters an, das in einer Art von rundum mit großen, exotischen Pflanzen in Kübeln gesäumten Atrium stattfand. Er schlürfte dabei mit einem Strohhalm aus einem hohen, schweren Glas einen Saftcocktail aus verschiedenen einheimischen Früchten. Die Instrumente schienen nicht richtig aufeinander gestimmt zu sein, und die Kinder vergriffen sich auch häufig im Ton, doch das störte ihn wenig. Dennoch fühlte sich Rupp zusehends unwohl auf diesem Flughafen, weshalb er zur Varig ging und nach einem Ticket nach Rio de Janeiro fragte. Man bedauerte, ihm mitteilen zu müssen, daß man ihm zwar ein solches verkaufen könne, die Flüge jedoch auf dem Inlandsflughafen Congonhas am anderen Ende der Stadt starteten. Wie er dort hinkomme? Am bequemsten mit dem Taxi, die Fahrt dauere – je nach Verkehrslage – etwa zwei Stunden. Wo die Taxis stünden? Dazu müsse er einfach das Flughafengebäude durch den Haupteingang verlassen, dann würde er schon sehen …
Sobald Rupp mit seinem Rollkoffer aus dem Schutz des Flughafengebäudes herausgetreten war, fand er sich von etwa einem halben Dutzend hemdsärmeliger, schwitzender Männer umringt, die ihn an der Jacke zogen und »Hey Mister: Taxi, Mister!« und »Cheap fare to hotel – where you go?« oder Ähnliches brüllten. Sie zogen an ihm herum wie an einem Beutetier, es begann ihm, der noch geschwächt von dem langen Flug war, bereits etwas schwindelig zu werden: Da wurde er auf einmal mit einem entschlossenen Ruck an den Schultern nach hinten gedreht. Er schaute in ein schwarzbärtiges Männergesicht unter einem schwarzen, rundkrempigen Hut. Vor den Ohren kräuselten sich lange, fadenartige Locken bis auf die Schultern. Langsam und dröhnend sprach es aus dem Mund dieses Gesichtes, und dabei funkelten Rupp die schwarzen Augen so eindringlich an, als wollten sie die gesagten Worte in seinen Verstand glühen: »Don’t go with these men! They might kill you. Cada um deles – evereyone of them!«. Damit verschwand der Schwarze in Richtung des Flughafeneingangs und Rupp spürte, wie von hinten erneut das Gezupfe und Gezerre an ihm begann. Er riss sich los und ging eiligen Schrittes wieder in das Foyer des Flughafens, fast rannte er dorthin zurück wie ein Schutzsuchender.
Der Jude aber war nirgendwo mehr zu sehen.
Rupp kaufte unverzüglich am Kundenschalter von Delta Airlines ein Ticket nach Montreal.
Am Abend bestieg er eine Maschine, die im Morgengrauen auf dem John F. Kennedy Airport von New York landen sollte. Etwa eine Stunde vorher war Rupp auf seinem Fensterplatz aufgewacht, in einer gekrümmten Haltung, die linke Schläfe an die Bordwand gelehnt. Durch den Kunststoff und die Kissenfüllung hindurch spürte er das beständige Vibrieren des Materials. Alle schienen noch zu schlafen, und Rupp hörte nur das verlässlich monotone Motorengeräusch unter sich. Er dachte kurz darüber nach, welche Landschaften er in dieser Nacht überflogen hatte: weite Teile des Amazonas-Gebietes, die gesamte Karibik, wie er annahm, die Bahamas … dabei hatten sich – wie immer – die stetigen Tragödien und Wunder tief unter ihm ereignet – möglicherweise überflog er gerade jetzt eine Herde von Walen, die den Atlantik hinauf zum Polarmeer wanderten.
Rupp brachte drei Stunden im Transferbereich des Flughafens zu, las die New York Times, das People-Magazine und einige Ausgaben von Sports. Er fröstelte unentwegt, so daß er bereits eine Erkältung oder gar eine Grippe auf sich zukommen sah. Doch er hoffte noch darauf, daß wieder einmal nur die Klimaanlage falsch eingestellt war. Er war im Übrigen froh, als er endlich das Anschlussflugzeug nach Montreal besteigen konnte.
Rupp kam dort kurz vor Mittag an. Das Wetter war trübe, doch es regnete nicht. Er aß eine Pizza in einem Pizza-Hut–Schnellrestaurant. Danach kaufte er in der Shopping Mall des Flughafens einige neue Kleidungsstücke, mit denen er die seit Tagen getragenen ersetzte und jene der Einfachheit halber in einer Kabine der Toilettenanlage ihrem weiteren Schicksal überließ. Bei dieser Gelegenheit fiel ihm auf, daß er gerade eben zum ersten Mal, seit er seine kleine Eigentumswohnung in Heilbronn verlassen hatte, den mitgeführten Rollkoffer geöffnet hatte.
Es machte ihm indessen einige Schwierigkeiten zu ermitteln, wann er das letzte Mal in einem Bett geschlafen hatte, er vermutete, daß es vor vier Nächten gewesen sein könnte. Daraufhin entschloss er sich, für die kommende Nacht ein Zimmer in einem Hotel zu nehmen. So ging er in einer kalten Dämmerung durch eine unspezifische Auto- und Gewerbelandschaft, seinen Rollkoffer immer hinter sich her über den holprigen Asphalt ziehend. Nach wenigen hundert Metern gelangte er zu einem frei zwischen einigen Zubringerstraßen stehenden Best-Western–Hotel, das er ohne Zögern betrat. Am Abend lag er dann auf seinem Bett und betätigte mechanisch die Programmtaste der Fernbedienung. Wohl einige dutzend Male musste er so durch die etwa fünfzig Kanäle gedrückt haben, die Intervalle wurden dabei immer kürzer, schließlich war es wohl wenig mehr als eine Sekunde, bis er zum nächsten Kanal schaltete, seine Augen empfingen jeweils nur noch kurze Lichtreize unterschiedlicher Intensität und Helligkeit. Irgendwann drückte er aus Versehen die Aus-Taste, und dann lag er noch einige Zeit einfach so da in der Dunkelheit, bis er sich doch noch erhob und sich auskleidete.
Er schlief tief und traumlos. Am Morgen hielt er sich so lange im Frühstücksraum des Hotels auf und frühstückte so ausgiebig, daß er vermeinte sehen zu können, wie das Personal deswegen bereits etwas nervös wurde. Dann ging er wieder hinüber zum Trudeau International Airport. Bis zum frühen Abend flanierte er dort durch die Passagen und Terminals, besah sich Zeitschriften in den Presseshops, verfolgte das ständige Kommen und Gehen, beobachtete das Wachpersonal. Dann aß er in einem Kentucky-Fried-Chicken–Restaurant zu Abend.
Später saß er in einer Bar im Untergeschoss des Flughafens, trank Scotch und dachte darüber nach, wie er weiterhin sein Leben gestalten könnte, als er unversehens in ein Gespräch mit einer Frau verwickelt wurde, die in seiner Nähe saß und die Unterhaltung mit der spöttischen Bemerkung eröffnet hatte, daß wohl niemand in Irland jenen »Fusel« schlucken würde, den er da gerade vor sich stehen hatte. Die elegant, doch in gewisser Weise auch nachlässig gekleidete Frau war eine irische Geschäftsreisende in den Vierzigern; weder ihr Gesicht noch ihre Statur fand Rupp besonders anziehend, doch sie war auf eine nicht unangenehme Weise extrovertiert und hatte ein schönes und – wie ihm schien – echtes Lachen, das sie oft hören ließ. Das machte viel wett, wie Rupp fand.
Das Ganze ließ sich zügig und vielversprechend an, und nach dem Genuss etlicher spirituosenhaltiger Mischgetränke, war Rupp zu seiner eigenen Verblüffung mit dem Versuch befasst, die Frau zu einer gemeinsamen Nacht im Best-Western–Hotel zu überreden, das er ihr bei dieser Gelegenheit sehr anpries. Die Irin schien prinzipiell nicht abgeneigt zu sein, fand die Idee so sweet, indessen aber unfortunately impracticable, denn sie hatte am nächsten Morgen in ziemlicher Frühe einen geschäftlichen Termin in Manhattan.
Am späten Abend bestieg die Dame stark alkoholisiert, doch mit bewundernswerter Contenance ein Linienflugzeug der Continental-Airlines zum New Yorker Flughafen La Guardia. Rupp begleitete sie noch bis zur Schleuse des Security-Checks, wo er ihr ein Treffen am nächsten Tag irgendwo in Manhattan vorschlug. Ein letztes Mal hörte er sie da lachen. So sweet! kicherte sie und hob dabei die Augen und die ausgestreckten Arme ein wenig nach oben, zur mit Neonleuchten behangenen Decke. Dann deutete sie auf den verlegenen Rupp im Stile einer amerikanischen Talkshow-Moderatorin und rief dem Sicherheitspersonal jenseits der Scheibe zu: This guy is such a sweetheart! Doch die Leute drüben zeigten keinerlei Reaktion. Daraufhin beobachtete Rupp verwundert, wie ihr lärmendes Glucksen in ein verhaltenes Schluchzen überging. In dessen Pausen teilte sie ihm in kurzen, stockenden Sätzen mit, daß auch ein Treffen in New York kaum möglich sein dürfte, da sie bereits am Mittag nach Albuquerque, New Mexico, weiterfliegen müsse, wo bereits am Abend der nächste Termin auf sie warte.
Da gab es Rupp mit einem innerlichen Achselzucken auf, und die Irin ihrerseits beruhigte sich ebenfalls. Sie verabschiedeten sich dennoch mit einigen innigen Umarmungen und Küssen, beinahe wie ein Liebespaar. Es waren Handlungen, die sie selbst wohl eigenartig fanden und die deswegen in jedem der beiden ein kurzfristiges Gefühl der Fremdheit gegenüber der eigenen Person hervorriefen. Er blieb sogar an der Scheibe stehen, bis die Frau durch die Sicherheitsschleuse gelangt war, daraufhin etwas unsicher tastend ihre Handtasche und ihren Schmuck wieder an sich nahm, ein letztes Mal in seine Richtung winkte und wenig später hinter den Regalen eines Duty- free–Shops verschwunden war.
Etwas über ein Jahr später hielt sich Rupp wieder einmal in Montreals Trudeau-Airport auf. Er war von Miami in den Norden hoch gekommen, und gleich nach seiner Ankunft tätigte er einige unaufschiebbare Kleiderkäufe in der Airport-Mall. Bei dieser Gelegenheit bemühte er sich wieder einmal darum, etwas mehr Interesse für die teuren Waren der Herrenausstattungsläden aufzubringen, denn wäre ihm das gelungen – das ahnte er –, so wäre ihm der Aufenthalt auf den Flughäfen noch kurzweiliger erschienen. Möglicherweise hätte er es sogar in der Kennerschaft von gehobener bis luxuriöser Herrenoberbekleidung so weit bringen können, daß ihm die Sortimente der Geschäfte nicht weltweit gleich erschienen wären, was wiederum vielleicht dazu hätte führen können, daß er dann sogar regelmäßig nach – na ja, vielleicht nach Budapest oder auch nach Barcelona geflogen wäre, um sich auf den dortigen Flughäfen bei seinen bevorzugten Herrenausstattern neu einzukleiden.
Doch der alleinige Grund, warum er Wildleder-Schnürschuhe eines italienischen Fabrikats, Hose und Jackett im Casual-Wear–Stil der oberen Preisklasse, ein Designer-Polohemd oder einen Pullover aus Cashmere trug, war der, daß es keine billigen oder auch nur preiswerten Kleidungsstücke auf den Flughäfen dieser Welt zu erwerben gab. Und was die Unterwäsche betraf: er trug Unterhosen, die mit großen Buchstaben und wie eine persönliche Trophäe mit einem Namen bedruckt waren. Er wusste nicht, warum dieser Männername auf seiner Unterhose prangte – das heißt, er wusste es schon, doch er wusste vor allem, daß er diese Unterhose nur deswegen trug, weil auf dem internationalen Flughafen von Manila keine anderen zu finden gewesen waren.
Und so stand er manches Mal in sein Spiegelbild versunken, von Kunstlicht etwas unvorteilhaft beleuchtet, zwischen überwiegend gelangweilten Reisenden, die sich mit einem Bummel in jenen Geschäften die Wartezeit verkürzten, während er Lautsprecher-Durchsagen einer kühl rieselnden weiblichen Stimme, die ihn niemals betrafen, hörte und auch wieder nicht hörte. So stand er also dann vor einem dieser hohen Spiegel, mit Gedanken, die in einer dieser vertrackten Schleifen gefangen waren: denn er sah und empfand, daß das, was er da vor sich sah, durchaus falsch sein musste, und dennoch erschien ihm dieses Falsche nicht etwa als unpassend – wie man es doch hätte annehmen können – sondern sogar fast als adäquat, irgendwie als stimmig, wenn auch auf eine eher unerfreuliche Weise.
Dieses Mal hatte er eine sehr mäßige Nacht im Best Western verbracht, und am nächsten Morgen dann fand er sich recht früh in einem Reisebüro im Flughafen ein. Er war sich an diesem Morgen sicher gewesen, daß er Nordamerika nunmehr verlassen würde. Seit längerem dachte er bereits an eine Flugreise nach Asien – er hatte China ins Auge gefasst, doch er befürchtete, daß die dortigen Flughäfen schlechte hygienische Verhältnisse aufweisen und auch sonst wenig zu einem längeren Aufenthalt einladen würden.
Zu seiner eigenen Überraschung kaufte er aber nun einen Flug nach Amsterdam für den gleichen Nachmittag. Er mochte Schiphol, der Flughafen war übersichtlich, fast sogar familiär; er pflegte dort immer in einem Savoy-Hotel abzusteigen, das bequem zu Fuß von den Terminals aus zu erreichen war, und in dem er bereits fast wie ein Stammgast behandelt wurde. Während die Angestellte seine Personalien in ihren Computer eingab und danach sein Ticket ausdruckte, wurde ihm seine zuerst überraschende Wahl immer plausibler: China machte ihm Angst, auf Schiphol aber freute er sich bereits, das war im Grunde ganz einfach zu verstehen. Es tat ihm nur leid, daß er mit der Air France fliegen musste und deshalb einen mehrstündigen Zwischenhalt im Aéroport Charles de Gaulle einlegen musste. Niemand in diesem Flughafen schien englisch zu sprechen oder sprechen zu wollen, keine Menschenseele, und man konnte sogar Schwierigkeiten dabei haben, eine Flasche Wasser zu kaufen oder eine Toilette zu finden. Das Flughafenpersonal war häufig übellaunig bis zur Gereiztheit, häufiger noch schien es sich aber ohnehin im Streik zu befinden. Einmal war er sogar offensichtlich vorsätzlich von mehreren dort angestellten Personen in eine falsche Richtung geleitet worden, was ihn eine Verschwörung vermuten ließ. Damals hätte er um ein Haar seine Anschlussmaschine verpasst und womöglich hätte er, wenn das eingetroffen wäre, auf diesem alptraumhaften Flughafen dann sogar nächtigen müssen.
Die Stunden bis zum Abflug verbrachte Rupp Zeitungen lesend im Ledersessel eines Starbuck-Cafés.
Er war sehr müde, als er um die Mittagszeit des nächsten Tages mit einer Lufthansa-Maschine in Schiphol landete. In Paris war es zu einer Verzögerung des Anschlussfluges gekommen, weil die Maschine der Air France technische Probleme hatte, oder vielleicht auch nur, weil die Fluggesellschaft sie anderweitig benötigte. Möglicherweise steckte auch einfach der Pilot irgendwo im Stau fest – er hatte die Durchsagen auf französisch diesbezüglich nicht verstanden, und die auf Englisch waren derart nuschelig und mit einem solch starken Akzent gesprochen worden, daß sie – wenn überhaupt – wohl nur von Franzosen hätten verstanden werden können. Es war ihm aber letztendlich auch egal, was mit der Air- France–Maschine nicht stimmte, sie konnte ihm sowieso gestohlen bleiben; noch vor Ablauf einer Stunde hatte er ein Flugticket der Lufthansa nach Amsterdam in der Manteltasche.
Als er um die Mittagszeit in Schiphol landete, war er so müde, daß er auf den obligatorischen Spaziergang nach der Ankunft verzichtete, sondern gleich hinüber in das Hotel ging, lange duschte, dann im Bademantel auf dem Bett lag und dösend auf die stummen Bilder des niederländischen Nachmittagsfernsehens sah. Das Starren auf den Bildschirm langweilte ihn bereits nach kurzer Zeit, doch er verspürte trotzdem keine Lust, hinüber zum Flughafen zu gehen. Überdies regnete es mal wieder. Er überlegte lange, ob er den Portier anrufen und ihm auftragen solle, für ihn eine Frau bei jenem Begleitservice zu bestellen, mit dem die Hotelangestellten, soweit er wusste, exklusiv zusammenarbeiteten. Schließlich entschied er sich dagegen – nicht vorwiegend aus moralischen Gründen, sondern einfach, weil er zu träge war und sich vor allem auch nicht auf den möglicherweise nur minimalen, aber dennoch unumgänglichen verbalen Kontakt einlassen wollte, der bei einer solchen Zusammenkunft seiner Meinung nach notwendig hätte stattfinden müssen. Stattdessen entschied er sich dafür, auf einem Hotelkanal einen jener Filme anzusehen, die in der auf seinem Nachttisch liegenden Informationsbroschüre skurrilerweise als »Natuurfilm« angekündigt wurden.
Die weiblichen Modelle in diesem Film fand er indessen wenig attraktiv, und die Männer gaben ohnehin allesamt jämmerlich dumme Karikaturen von Machos, was er indessen für genretypisch hielt. Einzig die Hauptdarstellerin, die in dem Film wohl so etwas wie eine Immobilienmaklerin darstellen sollte, wenn sie denn einmal bekleidet war (wobei sie überraschend geschmackvolle Kostüme trug, die Rupp wie Fremdkörper, wie Stilbrüche erschienen), hatte unbestreitbar einen schönen Körper. Auch ihr Gesicht war hübsch, doch leider war ihre Mundpartie immer von einem Ausdruck des hochmütigen Überdrusses entstellt, der sich mitunter fast bis zu einer Art von laszivem Ekel steigerte, wenn sie koitierte (obwohl ihre Partner Rupp nicht übermäßig abstoßend oder grob erschienen, soweit er das beurteilen konnte). Es schien ihm aber ohnehin, als ob dieser Ekel sich gar nicht so explizit auf die Männer bezog, die sie belagerten und deren Penetrationswünschen sie nachzukommen hatte, sondern daß der Ennui dieser Frau vielmehr von einer viel allgemeineren, Welt und Dasein umfassenden Natur war. Er vermutete, daß das wohl der Anlass dafür sein musste, daß sich auf einmal ein Gefühl in ihm breit machte, das beinahe einer Bestürzung ähnelte.
So unternahm er denn also nichts, sondern lag nur weiterhin stumm und reglos auf dem Bett, während vor ihm auf dem Bildschirm andauernd Paare und Gruppen kopulierten, was sie ganz lautlos taten, weil der Ton noch immer abgeschaltet war. Die Stille war fast gespenstisch: er musste annehmen, daß er der einzige Mensch zumindest auf dem ganzen Stockwerk war, und alles, was er hörte, war ein kaum vernehmbares Sirren der Bildröhre und das leise Zerspringen der Regentropfen auf dem Fensterbrett.
Nach dem Abendessen saß er noch ein wenig an dem Tresen der leeren Hotelbar, wechselte hin und wieder einen launischen Satz auf englisch mit dem indonesischen Barkeeper, und hörte dem gleichmäßigen Trommeln des Regens auf dem Glasdach des Wintergartens zu. In dieser Nacht schlief er wieder einmal tief und traumlos.
Den nächsten Morgen verbrachte er im Café der Besucherterrasse von Schiphol und überlegte, wo er sich von hier aus hinwenden sollte. Es regnete auch an diesem Tag.
Dem Wetterbericht einer holländischen Zeitung entnahm er, daß es in weiten Teilen Skandinaviens gerade schneite, und aufgrund von vagen Kindheitserinnerungen an die akustischen Eigenschaften von Schnee kaufte er sich daraufhin ein Ticket nach Helsinki (wobei er wieder einmal ernsthafte Befürchtungen hatte, verrückt zu werden oder gar bereits verrückt zu sein, ohne es bemerkt zu haben).
Am Abend saß er auf dem Vantaa International Airport Helsinki vor einer großen Fensterfront und schaute auf die verschneiten Rollbahnen draußen, die nur noch von Räumfahrzeugen befahren wurden. Nach Mitternacht wurde die Innenbeleuchtung des Flughafens auf Nachtbetrieb umgestellt, die Gänge, Sitzgruppen und Foyers waren nur noch sehr spärlich erhellt; sogar die beiden hohen Glastürme neben dem Flughafen schienen ihm wie gedimmt zu sein. Reinigungspersonal säuberte die Polstersessel und leerte die Mülleimer. Rupp hatte eine kleine Flasche Whisky im Handgepäck mitgeführt, die er nun langsam und bedächtig leerte, während dicke, finnische Schneeflocken schräg durch die Lichtkegel der Außenscheinwerfer fielen.
Am nächsten Morgen kaufte er endlich sein Flugticket nach Asien. Doch anstatt nach Peking oder zu einem anderen chinesischen Flughafen, buchte er einen Flug nach Tokio. Er wollte sich dort neu einkleiden, außerdem hatte er beschlossen, eine Fotokamera, vielleicht auch eine Videokamera zu kaufen, um damit in den Terminals der Flughäfen Bilder aufzunehmen.
Er verbrachte den Tag damit, dem schwächer werdenden Schneetreiben zuzusehen und verlor sich dabei in unbestimmten Träumereien. In der Dämmerung saß er endlich in einem Finnair-Airbus, der in das dicht über der Erdoberfläche stehende Wolkenmeer eintauchte wie in eine Art von dunklem Ur-Ozean. Eine Weile starrte Rupp von seinem Fensterplatz aus noch in diese Schwärze, wartete auf einen Lichtstreifen am Horizont, auf ein schwaches Leuchten aus dem Orbit, auf irgendetwas. Doch alles blieb dunkel und er schlief früh ein. Als er erwachte, hatte das Flugzeug bereits die sibirischen Wälder überflogen und auch schon weite Teile der mongolischen Steppen hinter sich gelassen. Rupp sah die Sonne als feuerrote Scheibe über den Horizont steigen und die ersten Strahlen auf die Sandhügel der Gobi werfen, deren Farbe sich innerhalb kurzer Zeit von einem dunklen, erdigen Braun, über ein Rostrot zu einem Kupferton und endlich zu einem hellen Ocker wandelte, das von hier oben fast golden wirkte. Später überflogen sie das japanische oder chinesische Meer und legten eine Zwischenlaung in Osaka ein. Der Flughafen war der Stadt vorgelagert und anscheinend auf einer Sandbank im Pazifik gebaut, nur durch eine kilometerlange Brücke mit dem Festland verbunden. Es war neun Uhr Ortszeit und der Weiterflug mit einer Maschine der Nippon Airways war erst für die Mittagsstunde angesetzt. Der Kansai International Airport war ein recht kleiner Flughafen, der nicht viel Zerstreuung zu bieten hatte, und so suchte sich Rupp eine Sitzgruppe mit Sicht auf die Bucht und blickte auf die Myriaden von Lichtpunkten auf dem pazifischen Ozean.
Der Flug zum Haneda International Airport von Tokio dauerte nur eine Stunde. Auch er lag an der Küste, und war ebenfalls, soweit Rupp beim Anflug erkennen konnte, weitgehend von Wasser umgeben (die Japaner mussten wohl eine Vorliebe für diese Art von Insel-Flughäfen haben). Der Haneda Airport war natürlich ungleich größer als der von Osaka, und Rupp blieb drei Tage lang; dort fand er alles, was er brauchte. Am dritten Tag zog er in Erwägung, von Japan nach Kasachstan zu fliegen, aber er ließ den Gedanken rasch fallen, er schien ihm sogar für seine Verhältnisse zu abwegig …
Ein weiteres Jahr danach, im Spätherbst, traf Rupp im Abflugbereich von Schiphol auf eine zierliche Frau mit dunkel umschatteten, braunen Augen. Es schien ihm, daß ihre rötlichen, langen Haare einer Wäsche bedurft hätten und er bemerkte auch noch einige andere, weniger auffällige Anzeichen einer beginnenden Verwahrlosung an ihr. Zu diesen im Kontrast stand ihre merkwürdig aufrechte, akurate Sitzhaltung und die gemessenen, ernsten Blicke, die sie auf ihre Umgebung warf. Auf ihren Knien ruhte eine große, gefüllte Plastiktüte; sie hielt sie an den Henkeln fest, in der Art, wie andere Frauen manchmal ihre Handtaschen halten.
Keiner der beiden konnte später erklären, wie und warum sie sich damals dort kennengelernt hatten. Sie saßen sich auf zwei Bankreihen gegenüber, sahen sich flüchtig an, beobachteten sich in der Folge verstohlen und irgendwann fingen sie dann schließlich an, miteinander zu sprechen – daran konnten sie sich wohl noch erinnern, und mehr ließe sich vielleicht auch gar nicht darüber sagen. Die Frau, die recht passabel, wenn auch mit einem starkem Akzent englisch sprach, stellte sich als »Jekatarina« aus »Leningrad« vor. Rupp ließ sich von ihr ihren Vornamen buchstabieren und fand die Schreibweise »interessant«, wie er ihr versicherte, worauf die Frau nichts erwiderte. Dann – gerade rechtzeitig bevor die entstehende Pause sich anschickte, überlang zu werden – fiel ihm ein, daß diese Stadt seit einiger Zeit doch wohl wieder St. Petersburg heiße. Sie erwiderte darauf nur, daß man eben ein Leben lang Leningrader bliebe, wenn man als solcher geboren und aufgewachsen sei. Sie sagte auch, daß sie nach Holland gekommen wäre, um als Köchin in einem russischen Restaurant zu arbeiten. Doch da hatte er mit seinem inzwischen geübten Blick längst erkannt, daß diese Russin in Schiphol gestrandet sein musste. Er vermutete, daß sie eine Geschichte mit einer jenen Banden, die den inzwischen weit verbreiteten Menschenhandel mit Osteuropäerinnen betrieb, hinter sich hatte, vielleicht sich sogar noch auf der Flucht vor ihnen befand und deshalb nicht in ihre Heimat zurück konnte. Aber er fragte nicht weiter nach, ließ sich stattdessen beschreiben, wie man am besten Piroggen buk – das einzige russische Gericht, an das er sich zu erinnern vermochte.
Sie wollte wissen, was er hier mache und wie er im Leben sein Geld verdiene. Auf die erste Frage erwiderte er nur knapp, daß er auf der Durchreise sei, doch bemühte er sich dann immerhin redlich, ihr die Sache zwischen Möbel Heyl und ihm einigermaßen verständlich zu machen. Als sie endlich zu verstehen schien, mussten sie beide darüber lachen.
Er fragte sich, ob er sie schön fände, doch er fand keine Antwort darauf und das beunruhigte ihn ein wenig, denn er befürchtete, daß sich bereits alle sinnliche Qualitäten für ihn einander angeglichen hätten und im Grunde von gleicher Wertigkeit geworden waren; ja, daß er in Wirklichkeit wie taub und gefühllos in einer ölig-zähen Flüssigkeit herumtrieb, die ihn für den Rest seines Lebens nicht mehr freigeben würde.
Doch er konnte sich immerhin sagen, daß er ihre ermüdeten Augen mit den zarten Halbringen darunter mochte – sie riefen irgendetwas in ihm wach, daß er nicht benennen konnte, doch unzweifelhaft einmal besessen haben musste, denn er glaubte es seit langem verloren, ohne daß er aber diesen Verlust jemals bewusst bemerkt hätte – wie er nun etwas verwirrt feststellte.
Unzweifelhaft tat er sich jetzt gerade selbst leid und zu diesem Selbstmitleid kam auch noch ein Gefühl der Beschämung darüber, denn er war überzeugt, daß diese Frau bereits seit einiger Zeit auf dem Flughafen lebte. Er lud sie zum Abendessen in sein Hotel ein, was sie genauso umstandslos annahm. Sie aß mit unverhohlenem Appetit. Er erzählte ihr dabei von seinem Alltag in der Luft und auf dem Boden und es erstaunte ihn so sehr, daß sie sich nicht übermäßig darüber zu wundern schien, daß er am Ende geradezu verunsichert war.
Später lag er auf seinem Bett und sah sich das holländische Nachtprogramm im Fernsehen an, danach die Nachrichten des Tages, die ihn, wie er fand, definitiv nichts mehr angingen. Während all dieser Zeit stand Jekatarina in seinem Badezimmer in der großen, nach drei Seiten verglasten Duschkabine unter dem warmen Wasserstrahl.
Rupp hatte zuerst überlegt, ob er ihr Geld anbieten solle und wie er dies erklären könne. Oder ob das überhaupt zu erklären sei. Er fragte sich, ob sie das vielleicht sogar erwarten würde oder ob er sie damit im Gegenteil sehr verletzen, womöglich demütigen könnte. Er hätte ihr sagen können, daß er genug davon habe, und daß er es ihr gerne gebe, und damit würde er überdies nichts weiter als die Wahrheit gesagt haben. Doch er war andererseits schon alt genug, um zu wissen, daß gerade diese Art von Wahrheiten zu den fürchterlichsten Missverständnissen führen konnten.
Später begann er, sich Sorgen zu machen. Er fragte sich, ob ihr dort drinnen unter der Dusche etwas zugestoßen sei und ob er hineingehen und nachsehen solle.
Als sie endlich in dem Hotelbademantel aus dem Badezimmer kam, war er beinahe schon eingeschlafen. Er sah gerade noch, wie sie sich auf der anderen Seite des Bettes ans Fußende setzte, sich den weißen, dünnen Mantel umständlich auszog und schnell unter die Decke kroch. Er tastete nach ihr, wollte ein Teil ihres Körpers berühren. Er fand ein Handgelenk und umfasste es. Sie entzog es ihm nicht. Kurz darauf schliefen beide fast gleichzeitig ein, ohne daß noch ein Wort zwischen ihnen gefallen wäre.
Am nächsten Morgen gingen sie nach dem Frühstück nach Schiphol hinüber und verbrachten dort gemeinsam den Tag. Jekatarina erschien Rupp viel schöner als am Vortag, was er mit der Nachtruhe im Hotel und ihrer so ausführlichen Körperpflege dort in Verbindung brachte. Er begann schon bald damit, sie in irgendwelche, ihm dafür geeignet erscheinende Ecken zu ziehen, um sie dort zu küssen und sich an sie zu drängen, zuerst eher verhalten und schüchtern, dann zunehmend fordernder. Er versuchte, sie zu einer neuerlichen Übernachtung im Savoy-Hotel zu überreden, doch sie lehnte das rundweg ab und wies ihn stattdessen darauf hin, daß er geplant habe, heute Abend ein Flugzeug zu nehmen. Er konnte sie lediglich dazu bringen, ihm zu erlauben, ihr in einem Modegeschäft einige neue Kleidungsstücke zu kaufen, die sie vorher fast widerwillig anprobierte. Er konnte nun nicht mehr umhin, sich einzugestehen, daß er verliebt wie ein Teenager war, und er befragte sich etwas bange, wie das zu seiner momentanen Existenz passe, und ob sich daraus womöglich mittel- oder langfristig irgendwelche Konsequenzen ergeben könnten.
Am Abend verabschiedeten sie sich vor der Check-In–Barriere. Jekatarina musste Rupp versprechen, daß sie in Schiphol auf ihn warten und auf sich aufpassen würde. Er wiederum gelobte ihr, bald wieder zurückzukommen. Daraufhin überquerte er die Grenze zum Transitbereich und bestieg eine Boeing 737 der KLM die ihn in der Nacht nach Johannesburg bringen sollte.
Rupp mochte es, in Flugzeuge einzusteigen. Er genoß die Sauberkeit und die Makellosigekit der Oberflächen in ihrem Inneren. Es erschien ihm dann jedes Mal ein wenig so, als würde er ein neues Leben betreten. Er mochte auch die formale, doch höfliche Unpersönlichkeit des Bordpersonals, seine profesionelle Zuwendung an die Passagiere, die geschmeidige, fast maschinelle Sachlichkeit seiner Bewegungen und Gesten.
Des Öfteren schon hatte er sich gefragt, was mit den Flugzeugen passiert, wenn sie schließlich einmal zu alt für den Flugbetrieb wären. Er hatte sich dann riesige Hangars vorgestellt, in denen sie in ihre Einzelteile zerlegt und diese anschließend in verschiedene Container sortiert würden. Am Ende dieses Vorganges wären sie dann verschwunden gewesen, und das wäre ganz so gewesen, als hätte es sie niemals gegeben. Flugzeuge waren, wie ihm schien, ohnehin alterslos; sie hatten keine Geschichte, jedenfalls keine, die ihnen anzusehen wäre. Ihr glatter, funktionaler Rumpf wies keine Wunden oder Beschädigungen auf. Sie schienen unberührt von der Zeit, ihnen stiess nichts zu. Und wenn dies doch einmal geschah, so war es von einer sauberen, finalen Gründlichkeit: sie zerschellten, zerbarsten, explodierten, und die Maschine (und mit ihr die Menschen in ihrem Inneren) wurde dann einfach ausgelöscht.
Das Letzte, was Rupp in dieser Nacht sah, waren weit unter ihm die Lichter einiger Containerschiffe, die einer Karawane gleich das Mittelmeer durchpflügten. Dann umfing ihn ein unruhiger, traumbewegter Schlaf, während die Maschine quer über die Sahara und das Gebiet des weißen Nils im Süden des Sudans flog, dabei von einer Turbulenz in die nächste geriet und deshalb fortwährend von starken Winden geschüttelt wurde. Vor dem Rudolfsee drehte sie rechts bei und nahm Kurs auf Nairobi, wo sie um etwa sieben Uhr Ortszeit auf dem Jomo Kenyatta International Airport landete, der in einer braunroten Sandwüste zu liegen schien. Dazu passte, daß das Hauptgebäude des Flughafens auf Rupp wirkte wie ein riesiges, befestigtes Eingeborenendorf, nur daß es anstatt aus Lehm aus Stahl und Beton errichtet war. Im Übrigen hatte er jedoch keine Zeit, sich näher mit den Besonderheiten dieses Flughafens zu beschäftigen, da er sich beeilen musste, den Anschlussflug der Kenya Airways nach Johannesburg zu erreichen.
Er war etwas verwundert, als man ihm keinen Fensterplatz anwies, wie er es bei der Buchung obligatorisch verlangt hatte, sondern einen zum Gang hin, doch er war zu müde, um zu insistieren. Gleich nach dem Start in Nairobi begannen in seinem Kopf die widersprüchlichsten Gefühle und Gedanken zu wüten. Etwas in ihm versuchte, ihm einzureden, daß es höchste Zeit wäre, dieses unsinnige Leben aufzugeben und zu einer normalen Existenz zurückzukehren. Er stellte sich darunter ganz landläufig ein kleines Eigenheim vor, vielleicht im Schwarzwald, und ein Alltagsleben als begüterter Privatier, zusammen mit Jekatarina. Sie könnten hin und wieder zum Einkaufen und Bummeln nach Basel oder nach Freiburg fahren … Er zog auch ein Landhaus in der Provence in Erwägung, vielleicht im Luberon … Sie hätten einen Hund haben können, ein großes, gutmütiges, wenn auch möglicherweise etwas überzüchtetes Tier, das hinten in dem geräumigen Kofferraum des Land Rover seinen Platz gehabt hätte …
Er konnte sich das durchaus vorstellen; ohnehin werde ihm zwangsläufig das Leben auf den Flughäfen – die ja gemeinhin und nicht grundlos für das Gegenteil von Gemütlichkeit und Geborgenheit gehalten werden – auf Dauer überdrüssig werden, davon war er überzeugt.
Dennoch setzte sich ein gegenläufiges Gefühl immer stärker in ihm durch, das ihm offenbar nahe legen wollte, daß er in der Tiefe seiner Seele am liebsten ein Flugzeug gefunden hätte, das er nie mehr hätte verlassen müssen und mit dem er auf den verschiedensten Luftrouten die Erde hätte umkreisen können. Voll bangen Zweifels stellte er sich dann die ärgerliche und alberne Frage, ob er Jekatarina zu einem solchen Leben hätte überreden können.
Während der Airbus der Kenya Airways über die Landenge zwischen den Ufern des Tanganjika-Sees und des Malawi-Sees flog und seinen Weg nach Süden über die lichten Wälder Sambias nahm, kreisten diese Gedanken immerfort in Rupps Kopf umeinander, ohne sich zu berühren oder gar die geringste Schnittmenge zu ergeben.
Deshalb kam es ihm im Grunde nicht ungelegen, als seine Sitznachbarn – ein Ehepaar, das am Anfang der sechziger stehen mochte – ein Gespräch mit ihm anknüpften. Sie flogen nach einem Familienbesuch in Amersfoort nach Hause zurück, und waren bester Laune, da sie endlich Großeltern geworden waren – dank »IVF«, wie die Frau aufgeräumt kundtat. Da Rupp sie daraufhin nur mit einem fragenden Blick ansah, klärte sie ihn auf, und sie schien dabei ein wenig stolz darauf zu sein, daß sie imstande war, einen solch vertrackten Fachbegriff fehlerlos und ohne Stocken hervorzubringen: In-Vitro-Fertilisation, Mijnheer!
Rupp fühlte sich nach dieser unerbetenen Vertraulichkeit immerhin auch seinerseits angehalten, ein wenig von sich preiszugeben. Also erzählte er in dürren Worten etwas von Heilbronn und seinem vergangenen Leben dort, was ihm schwer fiel, da seine Erinnerungen bereits am Verblassen waren. Die Fußgängerzone, die Burg, sein zentral gelegenes Büro, das bequeme Einkaufszentrum in »fußläufiger« Nähe – noch während er davon sprach, war er sich sicher, daß diese Worte unmöglich konkrete Bilder in den Köpfen seiner Zuhörer entstehen lassen konnten.
Sie wiederum erzählten von ihrem Heim in einer gated community am Rande von Johannesburg. Als das Paar vor einigen Jahren eines Nachts trotz der Sperren am Eingang der Siedlung überfallen worden waren und der Mann – ein Bergbau-Ingenieur – zwei glücklicherweise nicht lebensbedrohliche Schussverletzungen davongetragen hatte, entschlossen sie sich schweren Herzens dazu, zusätzlich eine drei Meter hohe Mauer um das Anwesen errichten zu lassen. Die Mauer wurde zudem mit Nato-Stacheldraht und Überwachungskameras bekrönt. Da die Gattin des Ingenieurs diesen Anblick nicht zu ertragen vermeinte, ließ sie die Innenseite der Mauer mit schnell wachsenden Kletterpflanzen begrünen und auf bestimmten, mit Bedacht ausgewählten Partien von Fassadenmalern Panoramen von einheimischen Landschaften nach ihren eigenen Fotovorlagen ausführen. Selbst den Stacheldraht wollte sie noch als Gerüst verwenden, um das sich bald schon Rosen ranken sollten, doch konnte ihr Mann sie wenigstens davon abhalten, freilich erst, nachdem auch der security-chief der community dringend davon abgeraten hatte, da jene Sicherheitsvorkehrung durch eine Begrünung völlig ihren abschreckenden Charakter verlieren würde.
Sie erzählten ihm von ihren im Garten freilaufenden Dobermann-Hunden, die im Gegensatz zu den sonstigen Wachhunden der Nachbarschaft »absolut schuss-sicher« seien. Auf Nachfrage Rupps erklärten sie ihm gutmütig lachend, daß das natürlich nicht hieße, daß die Hunde Metallwesten oder ähnliches trügen, da sie dadurch ja auch in ihrer Schnelligkeit und Beweglichkeit behindert worden wären, sondern daß »schuss-sicher« in diesem Zusammenhang lediglich bedeute, daß die Tiere darauf abgerichtet wären, sich nicht beim ersten Schuss winselnd in die Büsche zu verziehen, sondern sich vielmehr auch in einem solchen Fall einem eindringenden Feind entgegenzuwerfen. Der Ingenieur erzählte auch von den Waffen, die im Haus an »strategischen Punkten« ähnlich wie Feuerlöscher angebracht seien, doch in Verschlussvorrichtungen mit Stimmerkennungs-sensoren. Das, sagte er, stelle ja alles heutzutage kein technisches Problem mehr dar. Er erwähnte auch seinen Trainingsschießstand im Keller des Hauses, der in etwa die Ausmaße einer Kegelbahn habe. Seine Gattin schilderte Rupp wie einmal ein unvorsichtiger Besucher aus Europa aus reiner Abenteuerlust sowohl ihr Heim als auch die Siedlung unbemerkt verlassen habe. Sie hätten daraufhin ohne Zögern eine Sicherheitsfirma beauftragt, nach dem Entkommenen zu suchen. Tatsächlich wurde er nach einigen Stunden gestellt, bei bester Gesundheit zum Glück, was aber reiner Zufall gewesen sei. Der Wachmann aber, der den Besucher hatte entkommen lassen hatte, war noch am selben Tag gefeuert worden.
Trotz alledem waren die beiden vehemente Verfechter des Wohnens in jenen gated communities. Zur Veranschaulichung seiner Vorteile berichteten sie von Freunden, die sich aus »fehlgeleiteter Liberalität« gegen diese Wohnform entschieden hätten und nun abends solange in ihrem gepanzerten Wagen um ihren Block fahren mussten, bis einmal vor der Mauer ihres Hauses kein Passant (d.h. also kein potentieller Angreifer) mehr zu sehen sei und sie es wagen konnten, das funkgesteuerte Rolltor zu ihrem Domizil für einen Moment zu öffnen. Eines Nachts, als sich dauerhaft eine verdächtige Gruppe Farbiger ohne einen für sie ersichtlichen Grund dort auf der Straße aufgehalten hatte und es jenen Freunden nicht gelungen war, polizeiliche Unterstützung für die Rückkehr in ihr Zuhause zu erhalten, hatten sie sich sogar gezwungen gesehen, in einem Hotel zu übernachten.
Rupp hörte sich diese Erzählungen an und fand dann, daß sein Leben auf den Flughäfen dagegen ganz annehmbar sei.
Ab etwa elf Uhr Ortszeit saß Rupp auf dem O.R. Tambo International Airport von Johannesburg in einem recht bequemen, mit einem Zebrafell bezogenen Sessel in einer weiten, sehr hellen Flughafenhalle; es fröstelte ihn unentwegt, während die Welt draußen in der Hitze flimmerte, und er sah vor seinem inneren Auge bereits bedrohlich die kommende Erkältung heraufziehen. Er hatte schon häufiger feststellen müssen, daß die Neigung, die Klimaanlage zu übersteuern auf der südlichen Hälfte der Weltkugel geradezu die Regel war.
Überdies war er abgespannt und müde, hing leer in seinem exotischen Sessel und mühte sich, den Artikeln der örtlichen Daily sun zu folgen. Doch er konnte lediglich für den Bericht über das gestrige Rugbymatch zwischen den Bulls und den Central Cheetahs ein Gefühl aufbringen, das einem Interesse immerhin ähnelte.
Ab und zu erhob er sich, ging zu einem Münzfernsprecher in seiner Nähe, den niemand außer ihm zu beanspruchen schien, und wählte eine Nummer aus seinem abgegriffenen Notizbuch, doch er erreichte niemanden und so nahm er wieder seinen Platz ein. Einmal mehr meinte er sich an diesem Tag so zu fühlen, wie nur sonst eines der primitivsten Wesen auf diesem Planeten sich fühlen musste: abgetrennt von allem und annähernd empfindungslos. Wie eine Art von Schwamm vielleicht, doch dagegen sprach, das Schwämme immerhin eine Ortsbindung besaßen. Er grübelte noch etwas weiter über die Natur des Wesens nach, daß mit ihm gefühlsverwandt sein könne, doch er kam zu keinem Ergebnis, das ihm auch nur halbwegs überzeugend schien.
Gegen Abend besah er im Anschluss an einen Toilettengang im Waschraum lange sein Gesicht. Es sah nicht nur müde aus, sondern auch alt. Wohl hätte man ihn für jünger halten können, als er tatsächlich war; andererseits war er sich eigentümlich sicher, daß er vor zehn oder fünfzehn Jahren nur sehr schwer sich selbst erkannt hätte, hätte er sich zu jener Zeit so gesehen, wie er heute aussah. Dann fiel ihm noch ein, daß er irgendwo in irgendeiner Fernsehsendung einmal die These gehört hatte, daß Südafrika das Land der Erde sei, in dem die Menschen aufgrund der klimatischen Bedingungen am schnellsten altern würden.
Daraufhin kaufte er sich ein Ticket nach Madrid; er wusste selbst nicht, warum.
Als er in dem Flugzeug der Egypt-Air Platz genommen hatte, dachte er kurz an seinen Sohn, der ihn eigentlich – wie sie vor etwa zwei Wochen telefonisch vereinbart hatten – in Johannesburg vom Flughafen abholen wollte und nicht gekommen war. Er sah in seiner Erinnerung einen etwa fünfjährigen Jungen auf einem grünen Spielzeugtraktor in einem Garten in einer vergangenen, untergegangenen Welt, in der ihm alles andersartig gewesen schien, sogar das Grün des Rasens. Mit leichter Anstrengung gelang es ihm zwar auch, einen vielleicht etwas zu sehr von sich eingenommenen Teenager mit schönen, braungelockten Haaren zu sehen; dann einen Studenten, der seinen Vater stolz zu einer Probefahrt in seinem ersten Auto, einem Renault 16, einlud. Doch wenn er seine Erinnerungen sich selbst überließ, steuerten sie sofort wieder zurück in jene Zeit, als ein etwa fünfjähriger Junge in dem kleinen Garten des Reihenhauses in Heilbronn-Feuchtwangen spielte.
Nun hatte der Sohn bereits seit Jahren eine Stelle als Anästhesie-Arzt an einem Johannesburger Krankenhaus, und Rupp konnte sich vorstellen, daß er die Verabredung aufgrund einer Notfall-Operation, einem Notdienst oder sonst irgendetwas »mit Not« nicht einhalten gekonnt hatte. Wenn er aber ehrlich sich selbst gegenüber war, so konnte er sich indessen auch genauso gut vorstellen, daß sein Sohn sich im Termin geirrt oder ihn schlichtweg vergessen hatte. Was auch immer der wirkliche Grund dafür gewesen war, er war sich fast sicher, daß er ihn nie erfahren würde.
Auf jeden Fall war er froh darüber, daß er jetzt in einem Flugzeug saß, das am Ende der Nacht diesen Kontinent mitsamt seinen kleinen und großen Tragödien hinter sich gelassen hätte und ihn zurück nach Europa bringen würde.
Es war noch fast dunkel, als die Boeing über die graue und rostrote Kairoer Häuserwüste flog, und Rupp schlief noch, wie üblich embryonal in seinen Sitz verkrümmt und mit offenem Mund. Kaum hatte man ihn geweckt, rumpelte die Maschine auch schon über eine Landebahn des Cairo International Airport, der auf der Grenze zwischen der Häuser- und der Sandwüste errichtet worden war.
Volle vier Stunden musste er auf diesem Flughafen zubringen. Mit Glück fand er in der Halle ein bereits geöffnetes Café und darin eine Tasse überbrühten, bitteren Kaffees und zwei Croissants vom Vortag. Dann wanderte er durch die Hallen und Korridore, bestaunte die Lobbies und ihre Möblierung. Ihm schien, als sei er in die Kulisse eines zweitklassigen Kostümfilms über das 19. Jahrhundert geraten: hochlehnige, weiß-lackierte Stühle mit lachsfarbenem Polster und ziselierten Goldfüßen, runde Mahagoni-Tischchen mit geziert-schnörkeligen Beinchen, Chaiselongues mit golden lackierten Bordüren und ähnliches mehr. So mochte sich vielleicht ein aufstrebendes oder gerade emporgekommenes europäisches Bürgertum zu Anfang des 19. Jahrhunderts Komfort, Gediegenheit und feine Lebensart vorgestellt haben, doch selbst das hielt er für ungewiss. Es schien ihm aber jedenfalls so, daß dieser Teil der Welt seit langem eine andere Richtung genommen hatte und daß nun mindestens zwei große Teile dieses Planeten mit aller Macht auseinander strebten – wahrscheinlich waren es sogar noch mehr. Er saß auf einer dieser Chaiselongues und sann darüber nach, was dies bedeuten mochte. Er ließ an seinem Geist in groben Zügen die Entwicklung vorüberziehen, die sein Heimatkontinent in den letzten beiden Jahrhunderten genommen hatte. Dabei richtete sich sein Sinn eindeutig auf etwas, was man als eine Rettung hätte bezeichnen können, oder – um ein weniger dramatisches Wort zu bemühen – er suchte instinktiv nach einem Ausweg, wie er selbst etwas überrascht feststellte. Und das, obwohl er wusste, daß selbst dann, wenn ihm gegen jede Wahrscheinlichkeit eine rettende Idee gekommen wäre, sie wohl trotzdem keine praktische Konsequenz gehabt hätte, vielleicht nicht einmal für ihn.
Um zehn Uhr morgens Ortszeit bestieg er wieder einen Flieger der Egypt-Air, die ihn zum Barajas Airport bei Madrid brachte.
Dort langweilte er sich einen Nachmittag lang, kaufte ein paar neue Kleidungsstücke und entsorgte die getragenen auf der Flughafentoilette – so, wie es für ihn fast schon zur Routine geworden war. Am Abend flog er mit der Air France weiter nach Paris. Sein eigentliches Ziel blieb nach wie vor Amsterdam, doch aufgrund einer merkwürdigen Eingebung fasste er den Entschluss, die Strecke von Paris/Charles de Gaulle nach Amsterdam/Schiphol mit der Eisenbahn zurückzulegen. Vielleicht sollte diese geplante Bahnfahrt so etwas wie ein Einstieg sein, überlegte er, vielleicht auch nur eine Übung, eine selbstauferlegte Prüfung, ein zaghafter Versuch – ach, was wusste er denn schon, er wollte eben mal mit der Bahn fahren und das war vielleicht auch schon alles …
In Charles de Gaulle irrte er eine Weile umher, um den Zugang zum Bahnhof zu finden. Als es ihm endlich gelungen war, musste er feststellen, daß alle Fahrkartenschalter bereits geschlossen waren. Er hatte ganz naiv auf einen Nachtzug nach Amsterdam gehofft. Er stand eine Zeit lang mit seinem Rollkoffer ratlos auf einem menschenleeren Bahnsteig, bis ihn ein mitleidiger Amerikaner darüber aufklärte, daß sich die SNCF-Bediensteten im Streik befänden und auf absehbare Zeit hier keine Züge mehr fahren würden, schon gar nicht welche nach Amsterdam.
Als Rupp zurück in die große Abflughalle kam, näherte sich sein Zustand dem der Verzweiflung. Durch Zufall kreuzte sein planloser Weg einen Schalter für Expressverkauf und der Angestellte dort bestätigte ihm, was er bereits befürchtet hatte: er würde in dieser Nacht nicht mehr nach Amsterdam kommen. Die erste Verbindung dorthin bestünde morgen früh um sieben Uhr – eine Maschine einer tschechischen Fluggesellschaft. Rupp überwand seine Bedenken bezüglich jener Gesellschaft und erwarb eines ihrer Tickets. Daraufhin begab er sich in den Transitbereich und kaufte in einem gerade noch geöffneten Duty-free–Shop eine Flasche Whisky einer renommierten Fuselmarke. Die trank er zur Hälfte in kleinen und diskreten Schlucken im leeren Wartebereich eines nur noch spärlich beleuchteteten Gates, versunken in einem Sessel aus schwarzem Kunstleder und Chrom. Es ging ihm nicht eben gut dabei, doch was ihn aufrecht hielt, war der Gedanke, daß er morgen früh in Schiphol ankommen würde.
Er hatte nicht mitgezählt, wieviele Male er in jener Nacht von rüdem Wachpersonal aufgeschreckt und verjagt wurde; jedenfalls wanderte er fluchend und gähnend von einem Gate zum nächsten. Möglicherweise veranstalteten die dunkelblau Uniformierten bereits eine regelrechte Jagd auf ihn, zweifelsohne aber behandelten sie ihn genauso, wie sie einen Penner behandelt hätten.
Gegen vier Uhr wusste er sich nicht mehr anders zu helfen: er schloss sich auf einer Toilette ein, klappte den Deckel herunter, setzte sich darauf, lehnte den schweren Kopf an die kalte Metallwand, trank mit halbgeschlossenen Augen den Rest des Fusels und wartete. Doch die Dunkelblauen schienen keine Lust zu haben, ihm bis aufs Klo zu folgen.
Er machte sich dort nichts vor: in dieser Nacht war er sehr weit unten.
Zwischen fünf und sechs Uhr etwa hatte er sich dann von seinem Sitz erhoben, lange und erschrocken in den Spiegel geschaut und dann dauerhaft versucht, sich dieses Gesicht mit Unmengen von fließendem, kalten Wasser fortzuspülen. Schließlich gab er es auf. Daß bereits einige Passagiere in den Wartebereichen der Gates saßen, beruhigte ihn ungemein. Er nahm so weit von ihnen entfernt wie möglich Platz. Die dunkelblauen Sicherheitsleute waren nicht mehr zu sehen, dafür schob eine Gruppe Reinigungspersonal Wasserbehälter auf Rollen und anderes Putzwerkzeug durch die Gänge.
Als im Morgengrauen die tschechische Maschine gestartet war, bat er eine Stewardess, die er wegen ihrer Aussprache des Englischen eher für eine Französin hielt, um zwei Aspirin. Sie kam diesem Wunsch routiniert nach. Auch sonst hatte er während des Fluges keinerlei Beanstandungen.
In Schiphol fand Rupp Jekatarina bereits nach einer kurzen aber systematischen Suche: sie lag ausgestreckt auf einem der von ihr bevorzugten Polstersitzelemente und schlief. Niemand schien sie dabei gestört zu haben. Er hatte den Eindruck, daß sie sich freute, ihn wiederzusehen, doch sie war sehr müde. Sie verbrachte fast den ganzen Tag schlafend und dösend, den Kopf in seinem Schoß. Er saß träge und erschöpft am Rande ihrer Schlafstatt und las die Gedichte Puschkins in einer englischen Übersetzung. Jekatarina hatte das Buch in einem Presseshop aufgestöbert und ihm geschenkt. Er fragte sich nur kurz, ob sie es gekauft oder geklaut hatte – es wäre ihm im Übrigen fast sogar lieber gewesen, wenn sie es gestohlen hätte.
An diesem Abend standen sie gemeinsam im Hotel unter dem gleichmäßigen Wasserstrahl der Dusche, zwei Stunden etwa, vielleicht sogar etwas länger, er konnte es nicht abschätzen. Ihre Haut wurde jedenfalls immer weißer und weicher.
Am nächsten Morgen hatte sich der Flughafen verändert, alle Shops hatten über Nacht für das Weihnachtsgeschäft dekoriert: golden, rubinrot, silberfarben, tannengrün; Plüschfiguren in Kunstschneelandschaften – sogar unter der Decke der Haupthalle waren große, neonlichterne Sterne aufgehängt worden. Rupp sah das mit Missbilligung, er mochte diese Veränderungen nicht, und er erwog sogar für einen Moment, die nächsten Wochen vorzugsweise auf einigen arabischen oder asiatischen Flughäfen zu verbringen. Wäre er jetzt alleine gewesen, so hätte er das wahrscheinlich auch sofort getan.
Sie nahmen ein zweites Frühstück in dem Café der Besucherterrasse ein. Sie waren wie ausgetauscht gegenüber dem gestrigen Tag. Er fand sie so schön wie bisher niemals zuvor. Es mochte an diesem Ungreifbaren, Unbegreifbaren liegen, dachte er, diesem Fluidum oder dieser Aura – diesen Energien eben, von denen zwei Menschen manchmal umgeben sind, die gerade eine Nacht in den inneren Schichten des anderen verbracht hatten und wohlbehalten, wenn auch verändert wieder daraus zurückgekehrt sind.
Solche Dinge beschäftigten Rupp, doch er sprach von Petersburg oder Leningrad oder wie auch immer man diese Stadt nun zu nennen beliebte und ob sie nicht an diesem Tag, zur Feier dieses Tages sozusagen, gemeinsam dorthin fliegen sollten. Jekatarina strahlte ihn indessen nur an, und er musste die Frage noch einmal in etwas einfacherer Formulierung wiederholen, damit sie sie verstand. Daraufhin antwortete sie nur trocken, daß es Leningrad nicht mehr gebe und daß sie in St. Petersburg nichts verloren habe. Einmal mehr fragte er sich daraufhin, ob dieser Pragmatismus, der so untrennbar mit ihrem Wesen verbunden schien, denn wirklich ihrem Naturell entsprang oder nicht vielmehr allein aus der Summe ihrer Erfahrungen entstanden war.
Aber hier in Schiphol sei sie ja wohl auch nicht zuhause, merkte er zögerlich an.
Nein, sicher nicht, stimmte sie ihm zu.
Er war für einen Moment etwas ratlos. Dann schlug er ihr einen Badeurlaub in Acapulco vor. Es fiel ihm gerade nichts anderes ein.
Acapulco, sagte sie und lachte fast tonlos. Ja, Acapulco!, insistierte er, und war dabei fast etwas verärgert. Doch sie lachte nur wie über einen besonders gelungenen Scherz und strich ihm über das sich lichtende Haar. Sie war so viel schöner als er, dachte er, und soviel jünger wohl auch (er vermutete das nur, denn sie hatten einander bisher noch nicht nach dem Alter des anderen gefragt). Er wusste nicht, was um alles in der Welt sie nur an ihm fand, er gelangte da zu keiner Antwort. Er war weder attraktiv, noch klug oder geistreich, er gab nicht einmal vor, es zu sein. Er musste sich eingestehen, daß er ziemlich unansehnlich war. Jekatarina hatte auch keinen Anteil an seinem relativen Reichtum, noch schien sie daran interessiert zu sein. Er war nicht einmal wirklich originell. Er war nur ein Freak. Nichts anderes war er.
Doch mehr noch als alles andere fürchtete er, daß Jekatarina ihn nur nett fand. Wer weiß, sie war vielleicht eine jener Frauen, jener armen Frauen, die es ihr Leben lang vorwiegend mit einschlägigen Dreckskerlen zu tun hatten. Und über den ersten, der sie nicht vergewaltigt oder zumindest verprügelt, sobald sich eine ihm passend erscheinende Gelegenheit dazu bietet, sind jene Frauen dann dermaßen erleichtert – weil dieser nette Kerl der langersehnte, lebendige Beweis ist, nicht wahr, daß nicht alle Männer so sein müssen und daß sie vielleicht also doch noch Aussichten haben, das zu werden, was sie für eine normale Frau mit normalen Gefühlen halten mögen – sind sie also darüber so erleichtert, daß sie nichts Besseres und Eiligeres zu tun haben, als sich einzureden, sie würden jenen netten Kerl lieben, endlich lieben …
Ich bin nur ein Luftfahrt-Freak, sagte er da trotzig. Jekatarina aber brauchte eine Weile, um diesen Ausdruck zu verstehen.
Ich bin nicht gut für dich, fügte er noch hinzu.
Ja, das bist du wohl, sagte sie dann schlicht und überging seinen letzten Satz völlig: ein Luft-fahr-Freak.
Und nach einer Pause: Aber ich bin trotzdem gerne bei dir.
Er sah sie forschend an.
Du duschst sogar stundenlang mit mir ohne dauernd an mir herum zu machen, fügte sie mit einem Ausdruck der Anerkennung und des Erstaunens hinzu, indem sie die Brauen schräg nach oben zog. Und obwohl sie dabei ein Lächeln um ihre geschlossenen Lippen huschen liess, schien ihm, daß sie das ernst meinte.
Acapulco, fing sie dann unvermittelt wieder an – sie könne sich unter dem Wort keinen Ort vorstellen, irgendetwas mit Palmen wohl, aber sonst … Ob er denn schon einmal in Acapulco gewesen sei? Er verneinte. Und selbst wenn er dort schon gewesen wäre, überlegte sie laut, selbst dann wüsste er nicht, wie es dort aussähe. Sie lachte schon wieder tonlos und kam ihm dabei vor wie ein frühreifes, vorlautes Mädchen. Er grinste säuerlich.
Meinetwegen können wir auch nach Rio fliegen, schlug er vor. Dort sei jetzt Sommer, glaube er.
Rio … Samba tanzen in Rio?, wollte sie nun wissen und tat interessiert.
Ja, genau, bestätigte er, nun wirklich ärgerlich geworden.
Ach, du Freak, seufzte sie, und strich ihm dabei wieder über sein dünnes Haupthaar. Dann lächelte sie ihm noch einmal begütigend zu, bevor ihr Blick sich von ihm entfernte und sich auf die wartenden Flugzeuge heftete, die wie eine Herde großer, schlafender Tiere auf den Rollfeldern draußen im Regen standen. Rupp wiederum wandte seine Augen in die entgegengesetzte Richtung, nach Osten auf die winterlichen Felder. Kein Mensch war an diesem späten Morgen dort zu sehen, doch er wusste, daß im nächsten Jahr das Getreide wieder hoch auf ihnen stehen würde und das heiterte ihn etwas auf, er wusste selbst nicht, warum.
Da erschien, schräg von der Seite, Jekatarinas Gesicht vor ihm.
Wollte er denn nicht seit langem schon nach China?, fragte sie ihn.
Drei Tage später bestieg er eine Maschine der Lufthansa nach Frankfurt, von wo einige Stunden später ein Airbus der Air China mit Zielflughafen Shanghai Pudong International Airport starten würde. Seine seelische und gesundheitliche Verfassung hatte sich in den letzten Tagen zunehmend und erkennbar verschlechtert. Er müsse wieder in die Luft, hatte Jekatarinas Diagnose gelautet. Endlich stimmte er zu. Sie hatten dann in einem Büro der Air China vor einer beinahe wandfüllenden Karte des Landes gestanden und gestaunt. Jekatarina hatte gesagt, daß sie an seiner Stelle in eine dieser riesigen Städte fliegen würde, deren Namen sie noch nie gehört hatte, nach Tschengtschou beispielsweise oder auch nach Tschengtu, das etwa tausend Kilometer weiter in südwestlicher Richtung liegt. Er erwiderte darauf lediglich, daß er kein Abenteurer sei.
Sie hatten sich vor der Sicherheitsschleuse wie ein Liebespaar geküsst: lange, minutiös und kompliziert. Er bleibe nicht allzu lange in China, hatte Rupp zum Abschied noch gesagt, bevor er mit seinem Rollkoffer jenseits der Glaswand verschwand.
Es war schon dunkel, als das chinesische Linienflugzeug das Schwarze Meer überflog. Rupp sah die Lichter Sewastopols und Sotschis, und irgendwo über einem schwarzen, schweigenden Kaukasus schlief er ein. Während er schlief, flogen sie über das Kaspische Meer und anschließend über die Steppen von Turkmenistan, Usbekistan und Turkistan, wo wohl Angehörige der letzten nomadischen Reitervölker in unbekannten Träumen liegen mochten. Der Tag erreichte sie über der Taklamakan-Wüste. Von weit rechts glänzten die flachen Spiegel einiger Seen an den Ausläufern der Gobi herüber.
Das erste aber, was Rupp sah, nachdem er aufgewacht war, war eine riesige kobaltblaue Wolke, der sich das Flugzeug näherte. Sie war die einzige, die an diesem noch jungen Tag am Himmel zu sehen war. Aus ihrem Inneren vibrierte es in Rottönen, denn sie schwebte unmittelbar vor der Sonne. Diese war es auch, die den Konturen der Wolke Linien gab, die wie das blendende Licht von kochendem Metall waren. Die Form dieser Wolke aber war massiv und dicht wie ein Organ, dabei weit wie ein Kontinent, mit einer zerklüfteten, eigenwilligen Küstenlinie und kleinen Inselgruppen, die sich vor Zeiten von ihm gelöst hatten und nun den Anschein erregten, als würden sie in ein Unermessliches driften. An einigen weniger kompakten Stellen des Wolkenkörpers bahnten sich die Sonnenstrahlen Lichtkorridore, durch die hindurch sie in exakter, kegelförmiger Symmetrie schräg den Himmel durchschnitten.
Kurz darauf hatten sie sich jenem Körper bereits so weit genähert, daß er Rupps ganzes Sichtfeld einnahm, er sah nur noch das tiefe Blau und das pulsierende Rot dahinter. Er war inmitten von Schläfern der einzige Betrachter dieses Schauspiels, er hätte jemanden wecken, aufrütteln mögen, doch er tat nichts dergleichen und schaute nur. Ihm war, als würde er Zeuge von etwas, das noch nie ein Mensch gesehen hatte – wie irgendetwas Ungeheuerliches, was sich viele tausend Meter tief auf dem Grunde eines Ozeans ereignete, etwas, das Menschen bisher noch nicht einmal erahnt oder in dunklen und vagen, doch seherischen Träumen geschaut hatten.
Ohne darüber nachzudenken, füllte er noch einmal seine Lungen mit Sauerstoff, bevor das Fluggerät, in dem er sich befand, in den Bauch dieses Ungeheuers tauchte. Sofort begann er zu frösteln, obgleich durch dieses Eintauchen die Temperatur im Inneren des Flugzeugs unmöglich gefallen sein konnte. Gleichzeitig wurden sie von Luftmassen geschüttelt, und während der riesige metallene Rumpf ruckartig stieg und fiel, als wäre er ein altersschwacher, außer Kontrolle geratener Personenaufzug, drangen periodisch goldene Lichtblitze in das Innere dieser ebenso lächerlichen wie unglaublichen fliegenden Röhre. So ließ sich Rupp im Folgenden einige Minuten lang – wie es ihm schien – abwechselnd schütteln und blenden, manchmal ereignete sich auch beides zur gleichen Zeit. Er blieb dabei vollkommen ruhig, wie immer, wenn sich ein Flugzeug, dessen Passagier er war, in Turbulenzen oder selbst auch in größeren Schwierigkeiten als den gegenwärtigen, befand. Allein, er wunderte sich dennoch wieder einmal, daß das möglich war, daß er, Rupp, hier sein konnte, an diesem Ort, und diese Bilder von einer solchen, schwer fassbaren Großartigkeit so einfach zu sehen vermochte. Und in jenem Augenblick (und auch noch während der darauf folgenden), als die Maschine aus dieser ungeheuerlichen Wolke wieder hervorbrach und er seitlich vor ihr die riesige brennende Scheibe des Himmelskörpers sah, die das milchige Weiß des Äthers mit Feuerstrahlen überzog, da hörte er nicht allein seinen Herzschlag – den er übrigens irgendwo in der Gegend seines Kehlkopfes zu verorten glaubte – er sah ihn auch: als Halbbild mit verschwimmenden Konturen hinter den Lichtfluten; von unten sah er ihn, als regelmäßiges Schlagen eines undeutlichen Gegenstandes auf eine halbluzide Membran, die sich über ihm spannte. Doch konnte er weder die Beschaffenheit jenes Gegenstandes erkennen, noch die Ausdehnung der Membran abschätzen.
In jenen Augenblicken empfand er wieder diese Regung, dieses Gefühl, das er nicht anders klassifizieren konnte, als eine schlichte aber tiefgehende Freude über sein Dasein. In diesen Momenten war er sich beinahe sicher, daß er jedes Wissen oder auch nur Ahnen, wofür sein Leben eigentlich gut sein sollte, bereits verloren hätte, wenn er in Heilbronn geblieben wäre. Womöglich hätte er sich dann diese Frage nicht einmal mehr gestellt.
Einige Zeit später dann gelangte das Flugzeug wohl endlich in chinesischen Luftraum, wie er vermutete. Während des Bordfrühstücks flogen sie über das dünn besiedelte Gebiet des Transhimalaya, und als er später die Fragen auf gleich drei Zollzetteln – auf denen die Behörde sich etwa erkundigte, ob er Waffen, Drogen, ansteckende Krankheiten mitbringe oder ob er erkältet sei – allesamt verneinte, ohne sie zu lesen (was er immer so tat), überflog man bereits die wasserreichen Reisfelder des Ostens. Gegen Mittag beschrieb die Maschine im Landeanflug einen weiten Bogen über das ostchinesische Meer, auf dem reger Schiffsverkehr herrschte, kehrte weit draußen in der Bucht um, überflog in geringer Höhe zwei Inseln in der Mündung des Yang-tse und landete auf dem Pudong Airport, der nur durch einen schmalen Streifen vom Ufer des Flusses getrennt ist.
Dieser Pudong International Airport war ein Schock für den erfahrenen Flugreisenden Rupp. Er war so neu und modern wie ein Flughafen nur sein kann. Der Frankfurter Rhein-Main-Flughafen beispielsweise war hoffnungslos antiquiert im Vergleich hierzu. Als er an die Gepäckausgabe kam, standen die Koffer bereits in einer langen Reihe, und jedes Gepäckstück war säuberlich nummeriert. Das ganze Gebäude war wie eine Demonstration von Effizienz und Modernität. Hingegen stand er lange in der imposanten Halle, schaute hinauf an die Decke und überlegte, ob die hunderte von Metallstäben, die dort meterlang herunterragten, irgendeine praktische Funktion haben könnten oder wirklich nur einer merkwürdigen, rein dekorativen Laune von Architekten und Bauherren entsprungen sein könnten. Sehr wunderte er sich auch über den weiß-blauen bayrischen Biergarten dort, der der futuristischen Architektur jede Menge Holz und Grünzeug entgegensetzte. Vielleicht war das Holz auch nur Kunststoff, dem man mit den modernsten Druckverfahren eine täuschend echte Holzoptik verpasst hatte, und die Pflanzen waren dann wohl auch nur sehr naturgetreue Silikon-Repliken. Er wusste es nicht, war aber geneigt, es anzunehmen. Er verharrte etwas vor dem mit Zweigen umflochtenen Eingang, fragte sich, ob er sich nicht ein Weißbier und vielleicht ein halbes Eisbein genehmigen sollte, doch dann verschob er das auf den morgigen Tag. Stattdessen setzte er sich in Richtung der Hinweiszeichen zur Zugstation des Flughafens in Bewegung. Lange zog er seinen Rollkoffer durch Gänge und über Rolltreppen bis er in einer Tunnelröhre vor einem aerodynamischen Hochgeschwindigkeitsfahrzeug stand. Schon in der Eingangshalle der unterirdischen Station war er durch eine riesige Tafel darüber aufgeklärt worden, daß es sich bei den hier verkehrenden Zügen um die weltweit einzige Magnetschwebebahn handeln würde und daß sie eine sagenhafte Spitzengeschwindigkeit von 430 km/h erreichen würde. Die Wegstrecke zu dem dreißig Kilometer entfernten Zielbahnhof würden diese Bahnen in weniger als sechs Minuten zurücklegen.
Nun war Rupp nichts weniger als ein Liebhaber oder gar Spezialist für Zugreisen, doch dieses Gefährt verlockte ihn. Zögernd und unsicher stand er auf dem Bahnsteig, während sich die Türen des Zuges gleichzeitig öffneten, die Passagiere hineinströmten und sich Plätze suchten, auf denen sie dann erwartungsvoll der Fahrt entgegenblickten oder auch nur telefonierten oder etwa auf ihre Armbanduhren schauten. Dann schlossen sich nach einem kurzen Signal die Türen und fast lautlos fuhr der Zug an, um im nächsten Moment im Inneren der Röhre verschwunden zu sein. Rupp aber kehrte um und lief den ganzen Weg zurück, um im Ramada Airport Hotel ein Zimmer zu beziehen.
Das Hotel war natürlich ebenfalls in einem High-Tech–Gebäude untergebracht, war ganz im internationalen Stil gehalten und vermied konsequent selbst kleine folkloristische Ausstattungsdetails.
Abends lag Rupp auf seinem Bett und sah sich eine Folge einer chinesischen Soap-Serie an. Er verstand kein einziges Wort und dennoch war es offensichtlich für ihn, daß die Serie von brasilianischen Telenovelas inspiriert sein musste. Am nächsten Tag wollte er in der Airport-Mall einige Einkäufe tätigen und er stellte im Geist bereits eine Liste auf, nach welchen Artikeln er suchen würde. Weihnachten stand vor der Tür. Sein Mund verzog sich zuerst zu einem Schmunzeln, das bald in ein Grinsen überging und sich schließlich zu einem kindischen Kichern auswuchs. Er lachte darüber, daß er, Rupp, in Shanghai auf dem Bett eines Hotelzimmers lag und sich über Weihnachtseinkäufe den Kopf zerbrach.
Etwa eine Woche später saßen Jekatarina und Rupp im Café der Besucherterrasse von Schiphol. Es war winterlich kalt geworden. Er bemerkte, daß bald ein neues Jahrtausend anbrechen würde, und daß das seltsam sei. Sie erwiderte lakonisch, daß das im Grunde keine Bedeutung habe, wenn man es »rein objektiv« betrachte. Er widersprach ihr, sagte, daß vielleicht nur ein Prozent der Menschen, die jemals auf der Erde gelebt hätten, so etwas während ihrer Lebenszeit erlebt hatten. Doch sie beharrte darauf, daß auch dieser Umstand der Sache keine größere Bedeutung verleihen könnte. Die Chronologie der Zeit, sagte sie, könnte niemals etwas Besonderes sein, und im Übrigen wäre sie ohnehin relativ bis zur Beliebigkeit. Da wunderte sich Rupp wieder einmal, während Jekatarina ungerührt mit der Hand durch einige ihrer lang herabhängende Haarsträhnen fuhr und in die Strahlen der Wintersonne blinzelte, die grell durch eine nur nachlässig gereinigte Fensterscheibe einfielen. Er fragte sie nun etwas unvermittelt, fast schon überstürzt, ob sie die Jahrtausendwende trotzdem mit ihm hier in Schiphol verbringen wollte. Sie gab zurück, daß sich das, was sie anginge, wohl einrichten ließe, sie sich aber wundere, daß er diese Zeitenwende nicht in einem Flugzeug irgendwo über dem Himalaya oder auch nur über dem trockenen Baikalsee verbringen wolle. Sie lächelte traurig, während sie das sagte. Er erwiderte darauf nichts, sondern befragte sich vielmehr selbst, ob er für dieses Datum dann ausnahmsweise im Savoy ihr Zimmer im Voraus reservieren solle. Er hielt das wohl eher für unnötig, wer wollte schon die Jahrtausendwende in einem Airport-Hotel verbringen, doch andererseits konnte man nie wissen … Dann wandte er sich wieder an sie und fragte halb scherzhaft, ob sie denn nicht glaube, daß sich im neuen Jahrtausend alles ändern würde, vielleicht gar zum Besseren. Nun sah sie ihm ins Gesicht und sagte nur, daß sich bereits ohnehin alles geändert habe, in welchem Sinne könne sie ihm allerdings auch nicht sagen.
Schau, sagte sie dann, ich bin in einem grauen, halbverfallenen Leningrader Mietshaus aufgewachsen. Wenn ich aus dem Küchenfenster schaute, sah ich nur Häuser, die aussahen wie die Kopien von unserem, und das, soweit das Auge reichte. Und jetzt bin ich hier. Holland – das war für mich ein eisbedeckter See, auf dem Leute mit hohen Hüten Schlittschuh fahren. Und an einem Baum sitzt einer von ihnen, scheißt in den Schnee und grinst zufrieden dabei. Das war das Holland auf einem meiner Lieblingsbilder in der Eremitage. Als ich hierher kam, wusste ich natürlich, daß meine Vorstellung davon unsinnig ist, daß sie nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben kann. Trotzdem bin ich überzeugt, daß ich nur deswegen hierher gekommen bin.
Gut, aber dennoch ist hier nicht unser Platz, sagte er nach einer kurzen Pause und sah etwas betrübt darüber aus. Sie dulden uns, sie geben uns Asyl, aber es ist nichts für uns. Das mag stimmen, sagte sie nur.
Doch irgendwo, fuhr er fort wie jemand der sich durch eine Dunkelheit tastet, muss es doch möglich sein … daß wir … sein … können … oder etwa nicht?, schloss er beunruhigt. Sie seufzte nur.
Schau dich an, Herr Rupp, sagte sie dann etwas später: Du hattest einmal ein Haus in Deutschland, eine Frau, ein Kind. Später hattest du immerhin noch eine Wohnung in Deutschland und ein Kind in Afrika. Jetzt hast du nur noch deine Erinnerungen und Geld. Geld, das man dir für irgendwelche dummen, für einen erwachsenen Menschen unwürdigen Sprüche bezahlt hat. Alle Leute bemerken sofort, daß es nur dumme, wertlose Worte sind, und trotzdem bezahlen sie dir soviel Geld dafür, daß du damit für den Rest deines Lebens sinnlos um die Erde fliegen kannst, auf der Flucht vor der Dummheit, der Leere und all dem übrigen Irrsinn – im Grunde aber vor allem auf der Flucht vor Herrn Rupp, nicht wahr?
Na schön, Herr Rupp: in welches Haus möchtest du denn jetzt noch einziehen, mit mir einziehen – in das mit den dummen Sprüchen oder lieber gleich in das, das dem Wahnsinn gehört?
Er hatte dieser, für ihre Verhältnisse sehr langen Rede zugehört, dabei seinen schweren Kopf auf eine zur Faust geballte Hand gestützt und den Blick zunächst nicht von dem blendenden Weiß der Tischplatte gewandt. Er wusste, daß sie recht hatte. Schrullig, dachte er, sei er wohl zu nennen. Das war das Mindeste, man hätte leicht noch ganz andere Worte für ihn finden können. Und schon erschien ihm dieses Adjektiv tatsächlich vollkommen ungenügend für die Charakterisierung seiner Person, und er fügte daraufhin seinen Gedanken den Satz an: Ich bin ein törichter, furchtsamer Mann an der Schwelle des Alters.
Doch gleich darauf schien ihm unmöglich, daß das seine Worte gewesen waren, und überdies könnten sie wohl auch nicht ihn meinen. Töricht, furchtsam – wiederholte sein Geist langsam und prüfend, und er fragte sich, woher er plötzlich diese altertümlichen, fast schon ausgestorbenen Worte genommen hatte. Sicher hatte er sie nur irgendwann einmal in irgendeinem Buch in Bezug auf irgendeine Romanfigur gelesen.
Dann schaute er hinüber, schickte seinen Blick über die kahlen, schwärzlichen, nur mit Raureif bedeckten Felder. Bei ihrem Anblick glaubte er sich an etwas zu erinnern, doch es könnte möglich sein, daß es bloß Farben waren, die er vor sich sah, und vielleicht auch Geruchsspuren, die auf rätselhafte Weise plötzlich in ihm zu wirken begannen. Und daraus formten sich nun wunderbarerweise Bilder, und da sah er sich nun also einen Feldweg entlang laufen, an einem Abend im Mai oder Juni, der Himmel war tiefblau und wolkenlos. Seine rechte Hand ließ er an den hochstehenden Gerstenähren neben sich entlang streichen, zuerst langsam und zaghaft, dann beherzter und kräftiger, wie jemand über den Rücken eines großen Tieres streicht, nachdem er sich von seiner Gutmütigkeit überzeugt hat. Er griff tatsächlich hinein wie in ein weiches, lebendiges Fell, und selbst die rauhen Grannen des Getreides fühlten sich angenehm an. Und dann ging er wohl in das Feld hinein, wenigstens glaubte der gegenwärtige Rupp, daß dieser Mensch von damals das getan haben musste. Er verließ den Weg und ging hinein in diesen wogenden Ozean der Ähren, der ihn aufnahm und trug, der sich vor ihm teilte und ihn barg, dessen Halme ihn umspielten wie freundliche Wellen, ein unbegrenztes, grünes Gewässer, durch das für gewöhnlich nur der Wind strich, nun aber auch dieser Junge, der keine Angst zu verspüren schien vor der Unabsehbarkeit dieses Raumes …
Als Rupp wieder Jekatarina ansah, bemerkte er, daß sich auf der unteren Hälfte ihrer Augäpfel Tränen gebildet hatten. Da wandte er sich schnell wieder ab und schaute hinaus auf den breiten Gang der Abfertigungshalle dort unten, wo sich unablässig Menschen, vereinzelt oder in Gruppen, in die eine oder andere Richtung bewegten, die meisten eilig, einige sogar hastend, den Blick geradeaus nach vorne gerichtet, ganz darum bemüht, ihr Ziel schnellstmöglich zu erreichen. Manchmal standen sie sich gegenseitig im Wege, mussten einander ausweichen; er konnte mitunter den Unwillen darüber in ihren Gesichtern erkennen. Die Meisten von ihnen schoben mehr oder minder schwer beladene, käfigartige Metallwagen.
Er wandte sich wieder zu Jekatarina und lächelte zaghaft und ungeschickt. Er wollte nicht so lächeln, hätte stattdessen lieber etwas gesagt, das sich fest und entschlossen angehört hätte, ein unmissverständliches Versprechen gewesen wäre, etwas wie: Das ist vorbei. Und nach einer kurzen Pause noch einmal, bekräftigend: Das ist jetzt endgültig vorbei! Und dabei hätte er ihr gerne offen und ernst in ihre von Müdigkeit umschatteten Augen geschaut, so lange, bis sie begonnen hätte, leise, beinahe tonlos zu lachen. Er sah das vor sich, sah und hörte auch dieses Lachen, doch er brachte kein Wort heraus, schon gar nicht jene Worte, die er sich so dringlich herbeiwünschte. Stattdessen sah er sie weiterhin unbeholfen an und lächelte schief, er fürchtete schon, daß er gar nicht mehr damit würde aufhören können. Währenddessen dachte er Unkoordiniertes, was in seiner Summe vielleicht ungefähr Folgendes ergeben hätte: ich muss zumindest wieder stammeln lernen; wenn ich auch niemals wirklich werde reden können – aber das Stammeln sollte ich schon noch lernen …
Und dann dachte er es noch einmal – langsam, ausführlich und grausam: was findet sie nur an mir, wieso sitzt sie überhaupt hier – hier, bei diesem dauergrinsenden Idioten an der Schwelle des Alters? Hier bei diesem so unansehnlichen, rundum kümmerlichen Gattungsexemplar?
Ihre Augen hatten sich nun ganz mit Tränen gefüllt, doch sie weinte nicht. Und dann kam es völlig unerwartet doch zum Vorschein, dieses ihr eigene Lachen, das sofort wieder kehrtmachte und in ihr verschwand, als wenn es draußen Schaden hätte nehmen können. Er sah sie überrascht, aber dankbar an, während es still in ihr weiterlachte, wie ihm schien. Sie hielt dabei das Kinn auf die eine Hand gestützt und ihre Augen musterten ihn fast amüsiert durch den Schleier der Tränen; mit der anderen Hand aber strich sie leicht und behend durch sein schütteres Haar.
















 PWA-Zellstoffwerk Mannheim, Silbergelatinepapier handkoloriert, 3 x 117 x 120 cm, 1995/2017
PWA-Zellstoffwerk Mannheim, Silbergelatinepapier handkoloriert, 3 x 117 x 120 cm, 1995/2017